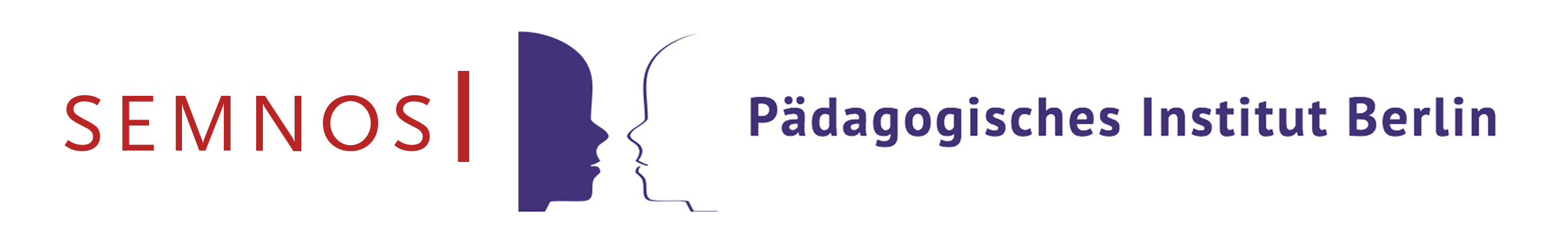Warum spielt ein Kind?, Teil 2: Phantasiespiel und die Bedeutung von „Intermediärräumen“
von Dr. Claus Koch
Phantasiespiel und die Bedeutung von „Intermediärräumen“
In der spielerischen Begegnung mit dem anderen entstehen, was der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott „unsichtbare Intermediärräume“ nennt. In diesem Räumen kommen die Innenwahrnehmung (mir geht es gut) und Außenwahrnehmung (der andere/die Welt kommt auf mich zu) zusammen. Neben solcherart Begegnung entstehen in dieser „Zwischenzone“ für das Kind aber auch „Möglichkeitsräume“, die es mit seiner eigenen Phantasie bereichert. Solche Spiel-Intermediärräume ergeben sich zwischen seiner eigenen Phantasie im Wechselspiel mit der äußeren Realität. Das Alter von 3 bis 6 Jahren, das der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget auch als die Phase „magischen Denkens“ bezeichnet hat, eignet sich für solche Phantasiespiele ganz besonders. Und hier eröffnet sich dem Kind eine Welt, in der es sich ganz nach eigenem Belieben ausmalen kann, was sein könnte, was sein würde, wenn …
Das vierjährige Kind setzt sein Holzschiff, das eigentlich nur ein kleiner Ast ist, in den Bach. Aus dem Holzstück wird ein Segelboot, im Segelboot sitzt es selbst und fährt den langen Fluss bis zum Meer. Wenn das Boot kentert, kommen ihm andere Boote zu Hilfe. Die ganze Reise spielt sich in der Phantasie des Kindes ab. Ebenso wenn sich das Kind in seiner Phantasie mit der oder dem identifiziert, die oder der es gerne sein will: Die Fee, die zaubern kann, das kleine Fohlen, das seine Mama sucht, der Baggerführer, Bauarbeiter, die Ärztin, die ein Kuscheltier wieder gesund macht, die Artistin, die bis unter die Zirkuskuppel schwebt und wenn auch nur am unteren Ast eines Baumes.