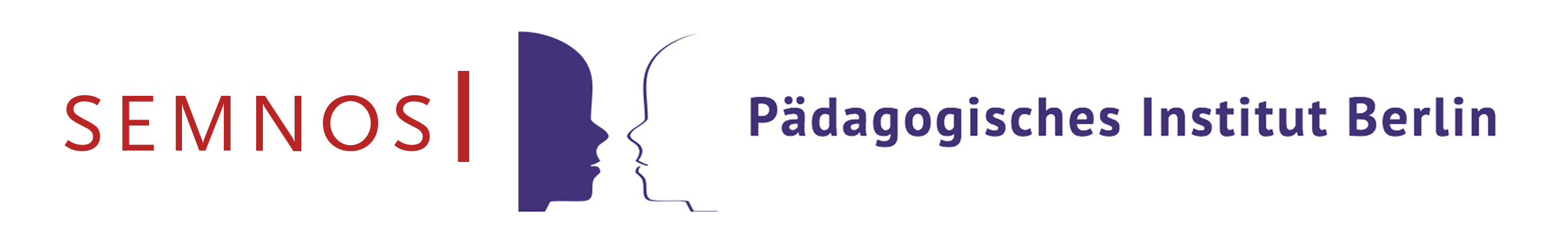Von Claus Koch
Im Folgenden geht es um die unterschiedlichen Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche in der Coronakrise mit Schulschließungen, Unterrichtsausfall und digitalem Lernen gemacht haben. Sozialer und familiärer Hintergrund, Wohnverhältnisse und die eigene Bindungsgeschichte spielen dabei eine wichtige Rolle. Hier wirkte die Krise wie ein Brennglas, das bislang zwar bekannte, aber immer noch zu wenig beachtete Strukturschwächen unserer Bildungspolitik zum Vorschein brachte. Im deutlich werden offensichtlicher Schwächen unserer Schulorganisation liegt aber auch eine große Chance, die gewonnenen Erkenntnisse jetzt produktiv zu nutzen.
Die unterschiedlichen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen
Da sind zum einen die Kinder und Jugendlichen mit zumeist guten Bindungserfahrungen, die unter den angesprochenen Umständen kaum oder gar nicht gelitten haben. Die, im Gegenteil, in gewisser Hinsicht sogar davon profitierten. Sie brauchten die persönliche Anwesenheit „ihres“ Lehrers oder „ihrer“ Lehrerin viel weniger, denn sie vertrauten ihren Fähigkeiten zu eigenständigem Lernen, weil sie sich schon als Kind selbstwirksam und auch im Lernverhalten autonom erlebten. Dass der Präsenzunterricht vielfach weggefallen ist, sahen sie für sich weniger als Nachteil, sondern sogar als einen Vorteil. Manche von ihnen fragten sich, warum sie denn überhaupt wieder in die Schule kommen müssen, haben sie ihrer Meinung nach zu Hause allein oder mit ihren Eltern effektiver, stressfreier und vor allem viel selbstständiger lernen können. Starre und im Präsenzunterricht überholte ritualisierte Formen sind mit einem Mal weggefallen. Jetzt war nicht nach 45 Minuten abrupt Schluss mit der Beschäftigung an einer Aufgabe oder an einem Thema. Wenn man sich einmal nicht wohlfühlte, brauchte man keine „Entschuldigung“, sondern ruhte sich einfach aus, um anschließend wieder loszulegen, und ja, auch um aufs Klo zu gehen, musste man nicht aufzeigen und sich eine entsprechende Genehmigung einholen. Das Lernen wurde plötzlich freier und selbstbestimmter. Und kam man einmal doch nicht allein weiter, konnte man sich an eine engagierte Lehrerin oder einen engagierten Lehrer wenden, die oder der einem nicht nur weiterhalf, sondern oft auch ein aufrichtiges Interesse bekundete, wie es einem gerade ohne Schule so geht. Statt Bulimielernen wurden von diesen Lehrern oft auch Themen angesprochen, die sonst kaum oder gar nicht im Unterricht auftauchten, zum Beispiel jetzt etwas über die eigenen Erfahrungen im Umgang mit Corona zu schreiben oder eine eigene Stellungnahme zu den getroffenen Maßnahmen zu verfassen. Doch bei aller hinzugewonnen Freiheit haben sich auch diese Kinder und Jugendlichen irgendwann doch wieder nach dem normalen Schulbetrieb zurücksehnt – vielleicht weniger, weil sie sich auf den Unterricht freuten, sondern mehr auf die sozialen Kontakte, die das Wiedersehen und den täglichen Umgang und Austausch mit Freunden und Freundinnen ermöglichte.
Ganz anders sahen es hingegen Kinder und Jugendliche mit schwierigeren Bindungserfahrungen. Ihnen fehlt häufig das Vertrauen in sich selbst, sie sind mehr auf positive Rückmeldungen und feinfühlige Begleitung der Lehrer*innen angewiesen. Auch Beziehungs- und Bindungswünsche spielen eine Rolle, um sich in der Schule sicher und aufgehoben zu fühlen. Hinzukommen alle jene, die häufig ohne die Hilfestellung ihrer Eltern in engen Wohnverhältnissen und ohne das notwendige digitale Handwerkszeug auskommen mussten. Ihnen fehlte der persönliche Kontakt zu ihren Lehrern besonders, insbesondere wenn sie mit den von ihnen verlangten Aufgabenstellungen allein nicht weiterkamen. Sie, die gerade jetzt Unterstützung gebraucht hätten, fühlten sich oft allein und im Stich gelassen, griffen in ihrem Bemühen, trotz der widrigen Umstände zu lernen und den Ansprüchen der Schule weiter zu genügen, zu oft ins Leere, weil niemand sie auffing und unterstützte. Diese Erfahrung mangelnder Unterstützung und empfundener Wertlosigkeit muss angesprochen werden, denn sie kann Folgen auch für ihre weitere Schullaufbahn haben. Diese Kinder wünschen sich die Öffnung der Schule herbei, auch um häuslichen Verhältnissen, manchmal verbunden mit Gewalterfahrungen oder lautstarken Konflikten unter ihren Eltern, zu entgehen. Diese Kinder sind dankbar, jetzt nach und nach wieder in den Schutzraum der Schule zurückkehren zu können und man sollte ihnen dabei so gut wie möglich entgegenkommen.
Die Chancen, aus der Krise zu lernen
Gerade die Kinder, die mit Schulschließungen, Unterrichtsausfall und dem Kontaktabbruch zu ihren pädagogischen Vertrauenspersonen am meisten gelitten haben, wünschen sich also jetzt, wo sich ihnen die Schulen wieder öffnen, feinfühlige Lehrerinnen und Lehrer, die nicht nur daran interessiert sind, den Lehrplan möglichst reibungslos zu Ende zu bringen, sondern bei denen sie sich mit ihren Erfahrungen in der schulfreien Zeit einbringen und an die sie manchmal auch ihre Beziehungs- und Bindungswünsche richten können. Lehrer*innen, die ein Gefühl für ihre Probleme und Nöte haben oder einfach „für sie da sind“. Hier zeigt sich, wie stark pädagogische Beziehungskompetenz und erfolgreiches Lernen voneinander abhängig sind und es gibt viele engagierte Pädagogen, die sich aufgrund der in der Krise wahrgenommenen Schwächen des Schulsystems gerade jetzt mit neuen Ideen zum Schulalltag zurückmelden. Neben dem sozial gerechten Ausbau digitalen Lernens gehört dazu, Lernen persönlicher, beziehungsreicher und offener zu gestalten.
Umgekehrt machen aber auch viele Lehrer*innen jetzt die Erfahrung, wie wichtig ihre persönliche Präsenz für die ihnen anvertrauten Kinder war und ist, und zwar über die reine Wissensvermittlung und Abarbeitung von Lernzielen hinaus. Wenn solcherart Erfahrung dazu führt, jetzt die eine oder andere Routine im Tagesablauf von Schule in Frage zu stellen und Veränderungen herbeizuführen, Schule zu einem „Beziehungsort“ zu machen, dann hat die Coronakrise am Ende sogar etwas Gutes erbracht und zwar für ALLE an Schule und Unterricht Beteiligten.