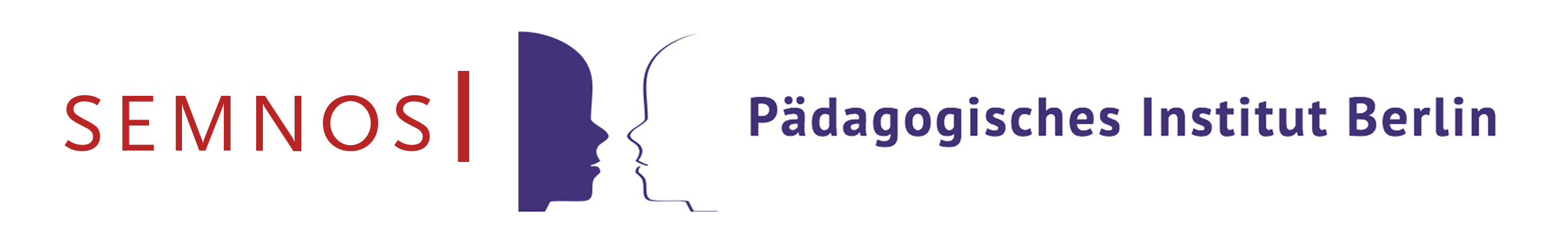Beziehungspädagogik

Annika – das Wirbelkind
1. Die Angst sehen/ Newsletter Mai 2024
Birgit Schüller
Wie aus Annika ein Schulkind wurde
Die Erzieherin steht freudestrahlend vor mir. „Ich bin so froh, dass Annika in ihre Klasse kommt!“ – mit diesen Worten kommt sie auf mich zu, als wir uns auf der Straße begegnen. Das verheißt nichts Gutes für mich! Ich freue mich nicht. Ich freute mich nie über ein erstes Schuljahr, denn die neuen Kinder verdrängen meine Viertklässler, die mir ans Herz gewachsen waren. So empfinde ich das, gegen jede Einsicht, gegen besseres Wissen. Was können die Erstklässler dafür, dass sie eingeschult werden und dass „meine“ Viertklässler nun auf weiterführende Schulen gehen? Jede Einschulung weckt Ängste in mir und wirft Fragen auf: Wie werden die neuen Schüler sein? Werde ich sie mögen? Wie soll aus so vielen unterschiedlichen Kindern eine Klasse zu machen? Werde ich die Kraft haben, mich auf so viele mir fremde Biografien einzulassen? Ein erstes Schuljahr bedeutet für mich immer eine große Anstrengung. Ich habe anfangs das Gefühl, dass mir jeden Morgen Kinder begegnen, die mich wie entzückende kleine Vampire aussaugen. Ich habe Angst vor der täglichen Erschöpfung, die sich darin niederschlägt, dass ich nach Schulschluss nur noch meine Ruhe haben will, mit niemandem reden will, das Mittagessen verweigere, weil mir alles zu viel ist. Nein, ich kann die Freude der zitierten Erzieherin nicht teilen. Im Gegenteil, ihre Freude macht mir Angst, signalisiert sie mir doch, dass da ein Kind in meine Klasse kommt, das besondere Aufmerksamkeit braucht. Mit Recht.
WEITERLESEN Text vom Mai 2024
2. Oder: Ins Leere gehen statt Beziehung/ Newsletter Juli 2024
Birgit Schüller
Das Losungswort von heute weiß ich nicht. Also bleibt Volker unter dem Tisch sitzen. Solange ich aber die Parole nicht sage, besteht keine Chance, meinen sechsjährigen Erstklässler unter dem Tisch hervorzuholen. Tina flüstert mir das Losungswort zu. Sie fühlt mit ihrer Lehrerin mit. Nach unten gebeugt nenne ich die Parole. Lachend krabbelt Volker unter dem Tisch hervor.
Aussichtslos war meine Situation als Lehrerin zu Beginn der 70er Jahre, wenn meine Kreativität hinter den Ansprüchen mancher Kinder zurückblieb. Ich lernte, dass Aktionen wie die beschriebene eingebettet waren in spielerische Phasen, die sich aus Lernsituationen entwickelten. Das entsprach zwar meinen Vorstellungen von Schule – und doch, dass kreatives Spiel auch Lernen heißt, brachten der jungen Lehrerin erst die Kinder bei.
Gleiche Szenen
Auch heute sitzen Kinder unter den Tischen. Spielerei entdecke ich nur selten, eher Schutz und Rückzug. Oder ist es Verzweiflung? Äußerlich gleichen sich die Szenen von damals und heute. Damals wie heute ist die Chance gering, die Kinder in den Unterricht hinein zu holen, wenn das Schlüsselwort nicht stimmt. Gleich ist auch das Verhalten der Kinder: Sie sitzen unterm Tisch. Doch Beweggründe, sich zu verkriechen, sind anders geworden. Dort war es Spaß und Freude der Kinder am Spiel, hier ist es Schwere und Hilflosigkeit.
Ich male nicht schwarz-weiß. Auch vor Jahrzehnten waren nicht alle Kinder, die unter den Tischen saßen, verspielt. Und heute werden nicht alle, die das gleiche tun, von Problemen bedrückt. Der Unterschied scheint mir in der Häufigkeit zu liegen. Mehr Kinder ziehen sich heute erkennbar zurück. Und ich finde den Schlüssel spät.
Gleich geblieben ist der Satz von uns Lehrerinnen: „Es ist alles viel schlimmer geworden.“ Mit „Es“ sind die Kinder gemeint, manchmal auch die Eltern. Vor vier Jahrzehnten stellten sich einige Lehrerinnen der Herausforderung, mit dem seinerzeit sich verändernden Verhalten der Kinder klarzukommen. Noch war man es gewohnt, dass das Wort der Erwachsenen galt. Widersprüche aus Kindermund hörten wir selten. Es sei denn, die Kinder kamen aus Elternhäusern, die sich mit einer „neuen“ Erziehung auseinander setzten. Dann trafen oft zwei Welten aufeinander. Viele Kolleginnen empfanden das alles als „immer schlimmer“. Sie trafen auf kritische Eltern, die vieles am Schulsystem in Frage stellten, Erziehungsziele intensiv diskutierten, die Kinder in ihrer Kreativität unterstützten, sie gewähren und sich ausprobieren ließen. Eine anstrengende, eine spannende Zeit! Ich habe viel hinterfragen müssen – und vieles lernen dürfen.
Aggressionen
Altmodisch komme ich mir vor, wenn ich das Wort „frech“ im Zusammenhang mit Kindern negativ gebrauche. „Der Oliver war so richtig frech!“ empöre ich mich einer Kollegin gegenüber. Wie häufig der Satz zum Verhalten der Kinder passt, erlebe ich zu Beginn des letzten ersten Schuljahres. Ich bin erschrocken, irritiert. Nie habe ich so viele Kinder erlebt, die untereinander und mir gegenüber Worte gebrauchen wie „Scheiße“, „Arschloch“ und ähnliche Beleidigungen. Kinder, die sich körperlich wehtun und gleichzeitig auffallend empfindlich reagieren auf Berührungen anderer Kinder. Ich bespreche mit den Kindern, was mir daran missfällt. Es entstehen Verabredungen und Regeln, was die Kindern in dieser Klasse dürfen und was sie unterlassen müssen. Schlagen, Treten, Hauen, Spucken, böse Wörter sind verboten. Gewünscht wird: gemeinsames Spielen, sagen, wenn man traurig ist, weil niemand mit einem spielt. Geradezu rührend reagieren die Kinder, als mir nach den ersten paar Schulwochen ein Kind anvertraut, dass es in dieser Pause mit niemandem habe spielen können. Viele Arme gehen hoch von Kindern, die sich zum gemeinsamen Spiel anbieten. Es stellt sich heraus, dass viele Kinder das Gefühl kennen, niemanden zum Spielen zu haben. Das Gefühl stimmt, auch wenn es nicht immer der Realität entspricht.
Regeln üben wird Teil des täglichen Unterrichts. Nach einigen Wochen sehe ich erste nennenswerte Erfolge. Strahlende Kinder sitzen vor mir, als ich sage, wie toll ich es finde, dass ich in den vergangenen Tagen keine schlimmen Wörter gehört habe. Ich gebe mich keiner Illusion hin. Ich habe sie nicht gehört! Zum Wochenabschluss frage ich die Erstklässler, wie es für sie ist, wenn sie sich verbal nicht verletzen. „Das ist besser, dann schimpfst du nicht!“ – Ungutes Gefühl: mein Stöhnen und Schimpfen, manchmal auch meine Verzweiflung scheint Änderungen zu bewirken. Einsicht wäre mir lieber. Besser gefällt mir die Erklärung eines Rabauken, der einen harten Weg der Veränderung geht: „Das tut dann so im Herzen gut.“ Er weiß, wovon er spricht. Er hat in der Klasse eine andere Welt entdecken dürfen, in der er den Schulvormittag lang nicht kämpfen muss, sich nicht durchsetzen und behaupten muss mit Kraftausdrücken und Körpereinsatz. Das kann er, das kennt er. Die neue, andere Welt tut seinem Herzen gut!
Ich freue mich über Kinder wie Sven, Tanja, Ahmed und andere, die in der Schule die Chance haben, ein anderes Miteinander zu erleben. Und gleichzeitig lasse ich im Geheimen unerlaubte Gedanken zu: „Das ist doch alles Wahnsinn! Wie soll denn das alles zu leisten sein? So viele Kinder, die so viel Erziehung zum Miteinander nötig haben. So viele, die dem Unterricht nicht folgen können, weil sie ständig abgelenkt sind. So viele, die nicht zuhören können. So viele, die frech sind. So viele, die mich nicht verstehen. Wie soll ich ihnen denn da Rechnen, Malen, Lesen beibringen? Es ist alles viel schlimmer geworden.“
Pass doch auf
Während der Pause, auf dem Flur, fällt ein rangelnder Viertklässler rückwärts fast in mich hinein. Mein ausgestreckter Arm und mein freundliches „Achtung, aufpassen!“ bremsen seinen Fall. Blitzschnell dreht sich der Junge um und schreit mich an: „Pass du doch auf, du hast mich nicht zu berühren und zu schlagen.“ Noch immer ruhig, beschreibe ich die Situation und verbitte mir den unfreundlichen Ton. Der Junge zischt: „Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen!“ Inzwischen empört, erwidere ich, dass ich sehr wohl etwas zu sagen habe und seinen Namen wissen möchte. Die Klasse des Jungen steht inzwischen um uns herum. Ein Freund bestätigt, ich hätte dem Jungen nichts zu sagen und äfft mich im Ton nach: „Sag mir deinen Namen!“ Der Junge und sein Freund tun so, als hätte ihnen niemand etwas zu sagen. Ihr Ton ist publikumswirksam, von den Mitschülern kommt Applaus. Fast die Situation entschuldigend kommt ein Junge an meine Seite: „Das ist mein Freund, der ist immer so.“ Solche Kinderreaktionen empfinde ich als rührend, solidarisch. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Junge sich im Ton vergriffen hat. Die Klasse muss zum Sportunterricht. Den Jungen bestelle ich zum Gespräch, morgen, in der Pause. Wird er wohl kommen? Er ist da. Wir beide sind allein. „Schön, dass du gekommen bist“, sage ich. Schweigen. „Was war denn gestern los?“ frage ich. Nach einem „Ich bin immer so“, entwickelt sich ein aufschlussreiches Gespräch. Der Junge weiß, dass sein Ton nicht passend war. Aber er und seine Klassenkameraden finden es lustig so zu reden. Und, darauf besteht er, auf Erwachsene muss er nicht hören. Ich spüre Misstrauen, viel Enttäuschung. Ich erkläre ihm, dass ich seinen Ton und sein Verhalten nicht als lustig empfinde. Dass meine Hand ihn beim Fallen gebremst und ich mich geschützt habe. Sein „Ach so“, signalisiert Verständnis. War die Berührung zu viel Nähe? Er versteht meine Kritik an seiner Wortwahl. Mit einem leisen „Danke und Tschüss“, geht er. Zurück bleibt mein Wunsch, öfter mit ihm zu reden. Dafür bleibt so wenig Zeit am Schulvormittag. Beim nächsten zufälligen Treffen auf dem Flur lächeln wir uns zu, uns verbindet eine kleine gemeinsame Geschichte. Ich streiche ihm über den Kopf. Er lässt es zu. Mehr braucht es erst einmal nicht.
Hört bitte zu
„Verstehst du mich denn nicht?“ Resigniert, verzweifelt hört sich die Frage an. Und dieser Satz, durch mehrfache Wiederholung schon lange keine Frage mehr, bekommt nur eine stumme Antwort: „Ja!“ Das Kind versteht mich wirklich nicht. Der Frage gehen sich wiederholende Szenen voraus: „Gib mir eine Antwort!“ „Warum redest du so?“ „Warum hast du geschlagen?“ Auf all das wissen die darauf angesprochenen Kinder nichts zu sagen. Sie verstehen meine Worte, aber ihren Sinn nicht. Wie auch? Die Frage passt nicht zum Geschehen. Und passte sie dazu, könnten die Kinder auch nicht antworten, denn sie können nicht erklären, warum sie getreten, geschlagen haben, ausgerastet sind. Oft wissen sie es nicht. Wie sollen sie da eine Antwort geben können? Hilflosigkeit steht mir ins Gesicht geschrieben. Meine Frage ist ein Zeichen meiner Hilflosigkeit. Die Situationen häufen sich. Nicht nur in meinen Klassen. Befreundete Kolleginnen stöhnen auch. Wir sind ratlos, verzweifelt, hilflos. Wie die Kinder. Aber wir Kolleginnen haben uns, wir können zusammen jammern, uns untereinander austauschen und gemeinsam Wege suchen. Wir stellen fest: Es ist nicht schlimmer geworden. Aber es ist anders geworden. Wie bei jeder Veränderung in der Welt der Kinder. Und wir hinken den Veränderungen hinterher. Wir haben Kinder vor uns, die bei alleinerziehenden Müttern leben, deren Eltern aus anderen Ländern kommen, Kinder aus Scheidungsfamilien, Kinder aus Familien mit Alkohol- und Drogenproblemen, Kinder, in denen mehrere Kulturen vereint sind, vernachlässigte Kinder. All das gab es auch „früher“. Was ist anders? Anders ist die Häufung der unterschiedlichen Themen und Biographien in einer Klasse. Anders ist die auffällige Unsicherheit der Eltern in der Erziehung, auffällig ist die Bindungslosigkeit der Kinder, auffällig ist, mit wie wenig Alltagsregeln die Kinder vertraut sind. Oder kenne ich die neuen Alltagsregeln noch nicht?
Viele der mir vertrauten Regeln sind den Kindern nicht bekannt oder sie leben sie nicht im Elternhaus. Zuhören! Können die Kinder das noch? Momentan bin ich nur genervt, wenn es um das Thema „Zuhören“ geht. Deprimiert bin ich ins Wochenende gegangen. Am Freitag bin ich laut geworden. Habe mir und den Kindern den Abschied ins Wochenende verdorben. Eingesponnen in ihrer eigenen Welt, in die sie noch ein Kind reingelassen haben, sitzen Sven und Chantale und freuen sich aneinander. Sie reden, lachen, spielen mit Mimik und Händen. Meine in die Klasse hineingesprochene Aufforderung: „Alle hören jetzt zu!“, dringt nicht in ihre Zweisamkeit. Hatte ich doch gerade mit den Erstklässlern besprochen, warum es wichtig ist zuzuhören. Richtig, ich habe darüber gesprochen. Wie viele Kinder ich erreicht habe, weiß ich nicht. Sven und Chantale gehören nicht dazu. Sie sind es nicht gewohnt, dann zuzuhören, wenn es von ihnen verlangt wird. Sven ist haltlos und einsam am Nachmittag. Der Schulvormittag bietet ihm Kontakte, er wird gesehen, gehört, er ist lebendig. Meine Stimme dringt nicht durch die Mauer, hinter der er mit Chantale lacht, plaudert und genießt. Meine Hand auf seinem Kopf, seinem Arm oder seiner Hand hätte eine Verbindung zu der Außenwelt: zu der Klasse sein können. Den Weg zu gehen, Svens Aufmerksamkeit durch eine Berührung in den Unterricht zu lenken, fällt mir nicht ein. Fällt mir manches Mal nicht ein. Ich bin genervt von den immer wiederkehrenden Situationen, von meiner einsam vorgetragenen Bitte: „Hört bitte zu!“
Allein
Chantale ist es gewohnt, ihr Leben alleine zu bestimmen. Die Erwachsenen zuhause lassen sie machen. Auch eine Form von Einsamkeit. Ihre Mutter sagt mir, dass sich das auswachse, dass ich sie, die Mutter, unterstützen soll. Sie weiß auch nicht weiter, ich soll Geduld haben, ich soll der Mutter helfen. Wobei soll ich helfen? Womit soll ich Geduld haben? Worauf soll ich warten und wie lange? Wann hat es sich ausgewachsen? Ich bin durcheinander. Chantale muss es auch so gehen. Kinder, die keine Hilfe, keine Regeln bekommen, deren Eltern sich aus der Erziehung oft raushalten, gab es immer. Halten die Eltern sich raus? Oder erziehen sie nur anders, so wie ich es nicht kenne? Eins ist anders: Es sitzen jetzt mehr solcher Kinder in meiner Klasse. Chantale erfährt keine Reaktion von den Erwachsenen in ihrem Elternhaus. Sie bestimmt die Gespräche der Erwachsenen, sie läuft mit ihren wiederholten Fragen und Bitten ins Leere. „Mama. Mama …“ Es kommt keine Antwort. Mit Sven am Freitag im gemeinsamen Kokon die Schulwoche zu beenden, tut ihr gut. Da ist jemand, der reagiert. Es muss nicht Sven sein. Estelle und Yunus liebt Chantale auch als Gesprächspartner.
Ist das schlimmer geworden? Ich meine ja. Die Kinder erleben sehr oft, dass sie ins Leere laufen.
Meine Bemühungen, die Kinder nicht ins Leere laufen zu lassen, tragen erste Früchte. Für Yunus war es schwer, die Regeln und Verabredungen des ersten Schuljahres einzuhalten. Meine Geduld, manchmal auch Ungeduld, werden auf eine harte Probe gestellt. Yunus fordert mich. Er hat es nicht gelernt, auf Erwachsene zu hören. Von klein auf lernte er, seinen Tagesablauf selbst zu bestimmen. Darin ist er stark. Verantwortung an Erwachsene abzugeben, Kind zu sein, sich anzulehnen, zu entspannen lernte er nicht. Er mag mich und will meinen gebetsmühlenartig vorgetragenen Wünschen nachkommen. Leise zu sein, hinzuhören, was besprochen wird, sich an Klassengesprächen zu beteiligen oder gar sich zu melden. Das sind Hürden, vor denen er täglich steht. Nach fast einem Jahr Schule steht er während einer Arbeitsphase plötzlich strahlend vor mir, als hätte er den Mount Everest bezwungen: „Ich muss an fünf Sachen denken, an das Heft, das Buch mitnehmen, zuhören, melden, viel reden. Ja?“ Nicht sofort verstehe ich, was er will. Mir fällt es wieder ein. Beim letzten Elterngespräch verabredeten wir „die fünf Sachen“ mit ihm. Ich kann es kaum glauben. Yunus hat seine Hürden benannt. Genommen hat er sie noch nicht. Wenn schon, er nimmt sie wahr. Glücklich sehe ich Yunus hinterher, der sichtbar stolz zu seinem Platz zurückgeht.
Yunus erinnert mich daran: ich darf mich nicht entmutigen lassen! Auch nicht von der nächsten gesellschaftlichen Herausforderung.
Ach ja, das Losungswort im ersten Schuljahr vor Jahrzehnten hieß – „Asterix“!