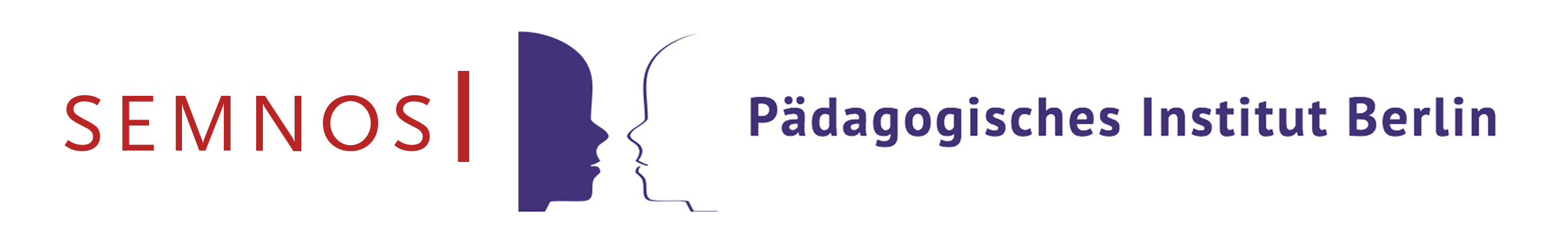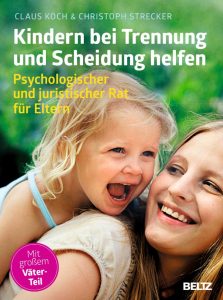„Werden, wie man sich selbst empfindet“ – ein Beitrag zur Abgrenzung von Selbstwert- und Selbstgefühl
Ein Beitrag von Claus Koch
In meinem letzten Beitrag „Selbstwert, Selbstwirksamkeit und soziales Dominanzstreben“ habe ich die Frage aufgeworfen, was geschieht, wenn sich Selbstwert und das Gefühl für Selbstwirksamkeit, zwei aus der Bindungstheorie abgeleitete wesentliche Dimensionen der Persönlichkeit, ablösen von einem kommunikativen und emphatischen Miteinander und sich stattdessen auf das Ziel sozialer Dominanz hin orientieren. In diesem Beitrag geht es erneut um eine kritische Diskussion dieser beiden aus guter Bindung resultierenden Persönlichkeitseigenschaften, dieses Mal jedoch unter dem Gesichtspunkt, warum die Unterscheidung von Selbstwert/Selbstwirksamkeit und Selbstgefühl im beratenden und therapeutischen Prozess eine so bedeutende Rolle spielen kann.
Sein Selbstwertgefühl entwickelt das Neugeborene und kleine Kind zunächst darüber, dass es sich in der täglichen Kommunikation mit seinen primären Bezugspersonen als „wertvoll“ empfindet. „Ich bin es wert, dass man mir auf meine Blicke, meine Gesten und Laute und späteren Worte antwortet“, empfindet das Kind, wenn Mutter und Vater oder andere ihm nahe Bezugspersonen auf die auf sein soziales Überleben gerichteten Kooperationsangebote feinfühlig eingehen. Wenn sich auf diese Weise nach und nach sein Selbstwertgefühl aufbaut, handelt es sich um eine Persönlichkeitseigenschaft, die bis ins Jugend- und Erwachsenenalter Schutz vor Mobbing und Feindseligkeiten bietet und gleichzeitig Selbstwirksamkeit verspricht: „Ich traue mir zu, das, was ich mir vornehme, auch bewerkstelligen zu können.“ Damit eng verbunden ist also auch das Vertrauen in sich selbst, das nur zustande kommen kann, wenn dieses Selbst für so wertvoll gehalten wird, dass es dieses Vertrauen auch zu verdient. Mit diesen, hier nur kurz zusammengefassten Wirkungen sind Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit in jedem Fall eine gute Basis für ein als sinnvoll und gelingend empfundenes Leben.