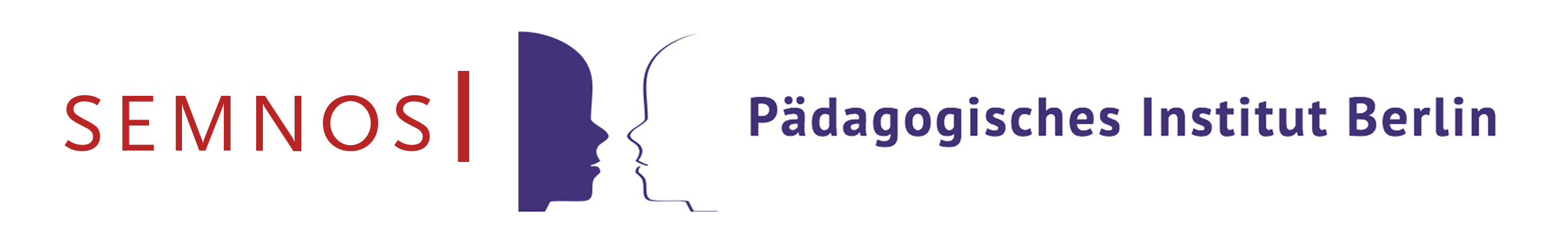von Dr. Claus Koch
Dass laut einer repräsentativen Studie im Auftrag des Deutschen Philologenverbands, der die Interessen von rund 176.000 Gymnasiallehrer*innen in Deutschland vertritt, etwa zwei von drei Lehrern unter beruflichem Stress leiden, verwundert nicht. Unabhängig von der jeweiligen Fragestellung, nach welchen Kriterien solcherart Stress ermittelt wird, würden ähnliche Ergebnisse wohl auch bei der Befragung anderer Berufsgruppen ermittelt werden können. In einer auf Konkurrenz, Leistung, Rendite und entsprechenden Sparmaßnahmen insbesondere im personellen Bereich ausgerichteten Wirtschaftsordnung gibt es, wie sämtliche Umfragen zeigen, im beruflichen Alltag kaum noch stressfreie Zonen. Insofern ist an dieser Umfrage interessanter, womit die Lehrer*innen denn ihren Stress begründen: An erster Stelle nennen fast 95% der Befragten die zu großen Unterschiede zwischen den einzelnen Schülern. Und etwas mehr als die Hälfte fügt auf dem zweiten Platz der „Stress-Rangliste“ hinzu, dass sie unter „verhaltensauffälligen Schülern“ leiden, die den Unterricht stören. Im Folgenden einige Bemerkungen zu den beiden auffällig häufig genannten Stressfaktoren.
Dass nahezu alle der befragten Gymnasiallehrer*innen das unterschiedliche Leistungsniveau in ihren Klassen als für sie größten Stressfaktor ausmachen, überrascht insofern, als unser Bildungssystem doch eigentlich alles dafür tut, um solche Unterschiede zu minimieren. So wird in den meisten Bundesländern noch immer ab Ende der vierten Klasse, also wenn die Kinder gerade mal 10 Jahre (!) alt sind, nach Leistung aussortiert, insbesondere wenn es darum geht, welche Schüler*innen fortan ein Gymnasium (und nicht eine Gemeinschafts- oder Gesamtschule) besuchen. Eine Klasse vor sich zu haben, in der sich Schüler in einzelnen Fächern, auch von ihrem jeweiligen Leistungsstand, kaum noch unterscheiden und wie einem Ei dem anderen gleichen bleibt dennoch eine kühne Phantasie, die hoffentlich auch niemals in Erfüllung geht. Gerade die Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen, ihren Interessen und kognitiven Leistungen machen doch den Reichtum einer Gesellschaft aus und dies gilt auch und besonders für die jungen Menschen. Zumal sich emotionale wie auch kognitive Entwicklungsverläufe von Kind zu Kind in hohem Maße unterscheiden und immer wieder auch „aufholen“ lassen, wenn man den Kindern und Jugendlichen genügend Zeit dafür lässt – die groß angelegten Entwicklungsstudien des Schweizer Kinderarztes und Autors Remo Largo haben es hinlänglich bewiesen.
Insofern beruht der so häufig benannte Lehrerstress darin, dass sie mehr oder weniger unausgesprochen davon ausgehen, alle der vor ihnen sitzenden Schüler*innen seien irgendwie auf dem gleichen Stand, zumindest hinsichtlich ihrer kognitiven Ausstattung, eine Voraussetzung, die erfahrungsgemäß nicht zu halten ist – von der Inklusion von Schülern mit besonderen Bedürfnissen ganz zu schweigen. Denn natürlich sind selbst bei einer bereits so hoch ausgelesenen Stichprobe wie den Gymnasialschülern hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Fächern und vor allem hinsichtlich ihrer Leistungsbereitschaft nicht alle gleich. Um den daraus resultierenden Stress zu mindern bedarf es, sofern er nicht auf der allzu bequemen Annahme beruht, alle Schüler sollten gefälligst dasselbe leisten können, um einfacher mit ihnen umgehen zu können, einer strukturellen Veränderung, die viele Schulen, jedoch weniger die herkömmlichen Gymnasien, bereits vorgenommen haben: Aussetzen der Notengebung zumindest bis zur 7. und 8. Klasse, Auflösung starrer Klassenverbände hin zu jahrgangsübergreifendem Unterricht, Projekte, die unterschiedliche Schulfächer unter einen Hut bringen, Stärkung kreativ-künstlerischer Fächer usw. Wobei alle Evaluationen zeigen, dass solche Maßnahmen nicht nur der Zufriedenheit und dem Stressabbau von Schülern und Lehrern zugutekommen, sondern auch der Leistung einzelner Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Abschlussprüfungen.
Ein zweiter Punkt, den die Studie zeigt und der mit dem bereits genannten durchaus zusammenhängt, ist die hohe Unzufriedenheit der Hälfte der befragten Lehrer*innen mit dem Verhalten der Schüler*innen, die in der Studie als „verhaltensauffällig“ bezeichnet werden: Auch diese sprechen gegen die gewünschten homogenen Verhältnisse in der jeweiligen Schulklasse.
Kein Zweifel, dass herausfordernde Schüler*innen einzelnen Lehrerinnen und Lehrern nicht nur im Unterricht, sondern auch persönlich viel abverlangen und sie schnell überfordern können, insbesondere wenn das Ziel bleibt, sie an denselben Kriterien zu messen wie die sogenannten „normalen“ Schüler, bzw. sie diesen in ihrem Verhalten wieder anzupassen. Dabei sind es ja zunächst nicht ihre schlechten Schulleistungen, die ihr Verhalten begründen, sondern ihre Beziehungserfahrungen – im Elternhaus, im Schulsystem, in der Peergroup, die das herausfordernde Verhalten hervorrufen. Ihr „auffallendes Verhalten“ als „Einladung“, wie es der kürzlich verstorbene dänische Familientherapeut Jesper Juul betont, zu begreifen, sich mit ihnen und ihrer persönlichen Beziehungsgeschichte auseinanderzusetzen, dafür sind aber nur die wenigstens Lehrer*innen ausgebildet, weshalb diese Kinder und Jugendlichen bis heute in den meisten Fällen erneut „aussortiert“ oder „abgeschoben“ werden, um die angestrebte „Homogenität“ in der Klasse wiederherzustellen. Hinzukommt, dass an immer noch viel zu wenigen Schulen Ressourcen zur Verfügung stehen, diesen Kindern und Jugendlichen wirklich helfen zu können. Aber diese Schulen gibt es. Sie arbeiten mit Supervision, „Inselgruppen“, die diese Kinder im Rahmen des normalen Unterrichts für ein oder zwei Stunden außerhalb des regulären Unterrichts am Tag besuchen, ohne marginalisiert zu werden, mit „multiprofessionellen“ Teams, pädagogischen Balintgruppen, wie sie unser Institut anbietet, laden Expertinnen und Experten ein und zwar nicht, um aus Lehrer*innen Therapeuten zu machen, sondern ihnen Möglichkeiten „spürender Begegnungen‘ und feinfühlige Begegnungen zu vermitteln, diese Kinder besser zu verstehen und ihnen, zusammen mit anderen Kolleg*innen und Fachleuten helfen zu können.
Dass dies noch viel zu selten geschieht, geht ebenfalls aus der angesprochenen Erhebung insofern hervor, dass sich Lehrer*innen nach wie vor als Einzelkämpfer*innen begreifen, denn nur etwa 20 Prozent (!) sehen in der Zusammenarbeit mit ihren Kolleg*innen einen zufriedenheitsstiftenden Aspekt und nur etwas weniger als die Hälfte – 45% – der befragten Lehrer*innen schätzt überhaupt die Arbeit mit Schüler*innen. Es bleibt hinsichtlich der Ausbildung auch von Gymnasiallehrern und Veränderungen in der Schulstruktur also noch eine Menge zu tun. Dort, wo solche Veränderungen bereits stattgefunden haben, aber lässt der Stress der Lehrer*innen signifikant nach – auch das zeigen entsprechende Befragungen und Evaluationen und gibt Anlass zu Hoffnung.
Siehe: