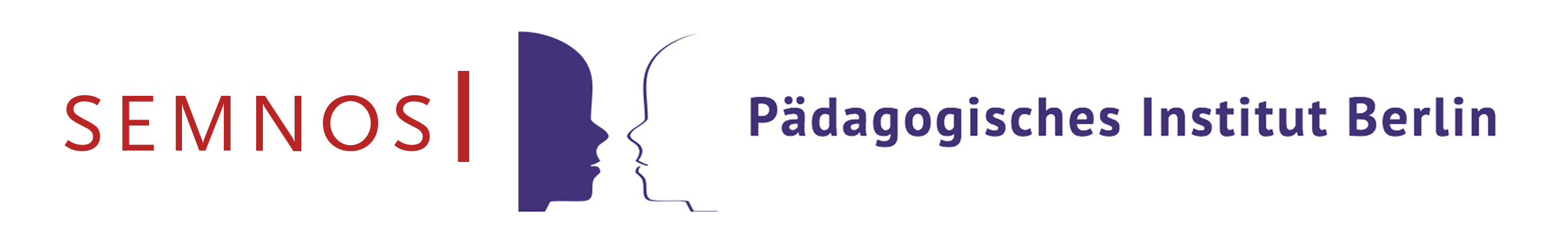von Dr. Claus Koch
Phantasiespiel und die Bedeutung von „Intermediärräumen“
In der spielerischen Begegnung mit dem anderen entstehen, was der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott „unsichtbare Intermediärräume“ nennt. In diesem Räumen kommen die Innenwahrnehmung (mir geht es gut) und Außenwahrnehmung (der andere/die Welt kommt auf mich zu) zusammen. Neben solcherart Begegnung entstehen in dieser „Zwischenzone“ für das Kind aber auch „Möglichkeitsräume“, die es mit seiner eigenen Phantasie bereichert. Solche Spiel-Intermediärräume ergeben sich zwischen seiner eigenen Phantasie im Wechselspiel mit der äußeren Realität. Das Alter von 3 bis 6 Jahren, das der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget auch als die Phase „magischen Denkens“ bezeichnet hat, eignet sich für solche Phantasiespiele ganz besonders. Und hier eröffnet sich dem Kind eine Welt, in der es sich ganz nach eigenem Belieben ausmalen kann, was sein könnte, was sein würde, wenn …
Das vierjährige Kind setzt sein Holzschiff, das eigentlich nur ein kleiner Ast ist, in den Bach. Aus dem Holzstück wird ein Segelboot, im Segelboot sitzt es selbst und fährt den langen Fluss bis zum Meer. Wenn das Boot kentert, kommen ihm andere Boote zu Hilfe. Die ganze Reise spielt sich in der Phantasie des Kindes ab. Ebenso wenn sich das Kind in seiner Phantasie mit der oder dem identifiziert, die oder der es gerne sein will: Die Fee, die zaubern kann, das kleine Fohlen, das seine Mama sucht, der Baggerführer, Bauarbeiter, die Ärztin, die ein Kuscheltier wieder gesund macht, die Artistin, die bis unter die Zirkuskuppel schwebt und wenn auch nur am unteren Ast eines Baumes.
In diesen Spielen wechselt das Kind seinen Realitätsbezug und alle Möglichkeiten öffnen sich. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Rollenspiel. „Mutter und Kind“- Spiele“ sind Klassiker, es können aber auch Puppen oder Stofftiere sein, die stellvertretend für das Kind handeln, manchmal reichen auch zwei Waschlappen, die miteinander kämpfen. Kinder können sich insbesondere im Rollenspiel stundenlang auf diese Weise beschäftigen und erschließen sich dabei immer neue Phantasiewelten. Phantasiewelten, in denen sich „nebenher“ auch der Umgang mit Ängsten erproben lässt, in denen aggressive Impulse ausgelebt werden oder Ablehnung und Enttäuschungen kompensiert werden können.
Spielkiller Zwang, Bewertung und Perfektionismus
Das soziale Spiel lebt von Annäherung und Erwiderung, aber auch von Zufall, von Gelingen und Nicht-Gelingen. Das macht die Spannung dieses Spiels und die Begeisterung von Kindern aus, wenn sie sich spielerisch egal mit was oder mit wem beschäftigen. Und das Phantasiespiel lebt von unendlichen Möglichkeitsräumen, die sich in ihm ergeben. Äußerer Zwang auf den oder die Spielende lässt Möglichkeitsräume einstürzen, sowohl im sozialen wie auch im Phantasiespiel. Damit meine ich vor allem die Aufforderung: „Du musst jetzt spielen!“ Oder: „Spiel dies oder jenes“. Möglichkeitsräume sind nur erlebbar, wenn sie im Kind selbst entstehen. Sie können keinem aufgezwungen werden, was übrigens auch für Erwachsene gilt. Zum Spielen bedarf es eigentlich keiner Vorbereitung, und wenn überhaupt, dem Kind eine entsprechend „zwanglose“ Umgebung zur Verfügung zu stellen. Einen Spielplatz, der dem Kind nicht vorschreibt, was es zu tun hat. Dichtes Gebüsch reicht auch. Natur. Wald.
Kinder kommen dann ganz von selbst darauf, was sie spielen wollen, gemeinsam oder manchmal auch für sich allein. Das ist bei Kindern übrigens ganz unterschiedlich. Manche bevorzugen das Spiel mit anderen, andere ziehen sich gerne zurück und spielen stundenlang in ihrer Phantasie allein für sich. Manche Pädagoginnen neigen spontan dazu, solche Kinder wieder in den sozialen Kontext zurückzuholen, vielleicht, weil sie Mitleid mit dem Kind haben, sein Spiel als Verlassenheit deuten usw. Manchmal mag das zutreffen, aber auch hier sollte man das Kind zunächst gewähren lassen. Kinder ohne Vorbelastungen finden von sich aus zurück in soziale Beziehungen. Fällt uns ein Kind dadurch auf, dass es sich für sein Spiel keine Partner sucht, dass es immer abseits vom sozialen Geschehen hockt, dann sind vielleicht seine ersten spielerischen Kontakte mit seinen Bezugspersonen gescheitert.
Spielkiller Leistung
Neben dem Zwang zu spielen ist der größte Spielkiller der Leistungsgedanke, wenn also das Spiel Mittel zum Zweck wird, etwas zu „können“ oder etwas via Spiel zu leisten. Dieser verkehrte Spielansatz, der Spontaneität, Phantasie und die Freiheit des Kindes künstlich versucht zu beschneiden, hat viel mit der neoliberalen Idee zu tun, man solle sich immer an dem ausrichten, was einem unmittelbar von Nutzen ist. Aus „Ich spiele, also bin ich“ wird „Ich spiele, weil es mir persönlich etwas bringt“. Das beginnt bereits in vielen Kindergärten und Kitas, wenn das „Lernen“ zum Hauptzweck des Spiels wird. Die Beratungsfirma McKinsey hat diesen Ansatz perfektioniert, wenn der Kindergarten zum „Haus der kleinen Forscher“ wird. Was niedlich klingt hat einen fahlen Beigeschmack. Das Spiel wird auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet, eine Aufgabe zu lösen und sie zu erfüllen. Es geht nicht darum, dass beim Spielen nichts gelernt werden soll. Aber es geschieht doch ganz von selbst, wenn das Kind, ob in der Wirklichkeit oder in seiner Phantasie etwas ausprobiert, sich darüber seine Gedanken macht, wenn es aus seinem Scheitern etwas lernt.
Neben solchen mittlerweile ziemlich verbreiteten Begrenzungen der ursprünglichen Spielidee des Kindes, wird in der Schule daraus Methode. Hier zählt in den meisten Fällen nur noch der Leistungsgedanke, der sich spätestens, wenn die Kinder acht oder neun Jahre sind, in der Notengebung ausdrückt. Warum spielen denn Kinder in den Schulpausen miteinander – eben deswegen, um sich vom ständigen stillsitzen und „etwas leisten müssen“ zu erholen.
Warum spielen Kinder?
Kinder spielen, um sich selbst in der Beziehung zu ihrer Umgebung zu erfahren. Sie tun es nicht bewusst und zu Beginn ihres Lebens ohne jeden Plan. Spielerisch und jenseits jedes Leistungsgedankens wollen sie einfach nur sich selbst und die anderen spüren und erreichen. Gelingt es ihnen, was meistens der Fall ist, sind sie im Spiel ganz bei sich und dem anderen. Fühlen sie sich dabei sicher und geborgen, dann können sie ihre Reisen auf unbekanntes Terrain antreten und immer mehr ausweiten. Dann machen sie sich buchstäblich oder in ihrer Phantasie auf in unwegsames Gelände, neugierig und ohne Angst verlassen sie den sicheren Hafen ihrer ihnen bedeutendsten Bezugspersonen und wagen sich hinaus ins Leben wie auf ein offenes Meer. Wenn alles gut läuft, behalten sie ihre Phantasie bis ins Erwachsenenalter. Meint es die Wirklichkeit nicht so gut mit ihnen, dann spielen Kinder auch und ihr Spiel verdient unseren allerhöchsten Respekt. Es kann ihre Ängste für kurze Zeit vergessen machen, es trägt ein Stück von „Normalität“ in ihr Leben. Unabhängig von ihrem jeweiligen Schicksal werden sie dann zu den spielenden Kindern, wie wir sie auf der ganzen Welt finden.
Bearbeitete Version eines Vortrages, gehalten am 24. September in Kirchzarten auf einer Veranstaltung von KukuK e.V., Spiel – und Naturräume