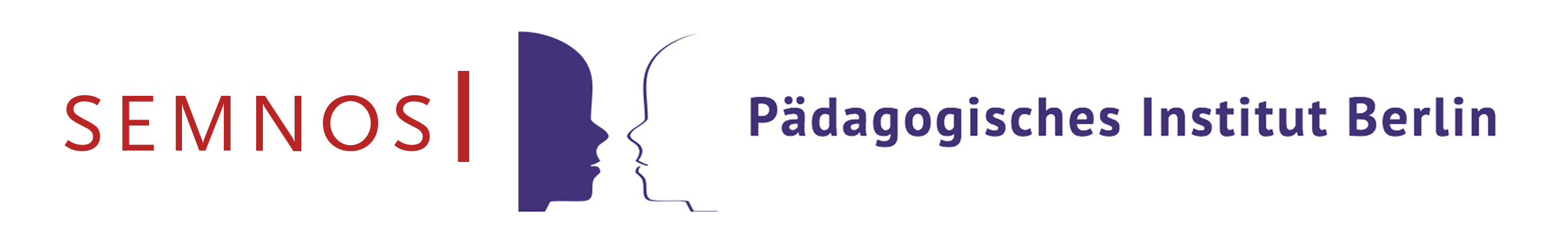SERIE Angst (6): Angstfresser
Michael Ende hat eine schöne Geschichte vom Traumfresser geschrieben. Zusammengefasst geht sie so: Die Tochter eines Königs hat schlimme Alpträume. Der Vater beauftragt alle Heiler, seine Tochter davon zu befreien. Doch niemand kann helfen. Da zieht der Vater in die Welt hinaus, um Hilfe zu holen. Doch alles ist vergeblich. Da sinkt er am Ende der Welt auf einen Stein und weint. Nun kommt ein seltsames Wesen auf ihn zu und fragt, warum er so weine. Der König erzählt seine Geschichte. Das Wesen antwortet ihm: „Das trifft sich ja gut. Ich bin ein Traumfresser. Ich ernähre mich von Träumen. Je schlimmer die Träume sind, desto lieber esse ich sie.“ Der Traumfresser begleitet den König nach Hause und frisst die bösen Träume der Tochter weg. (mehr …)