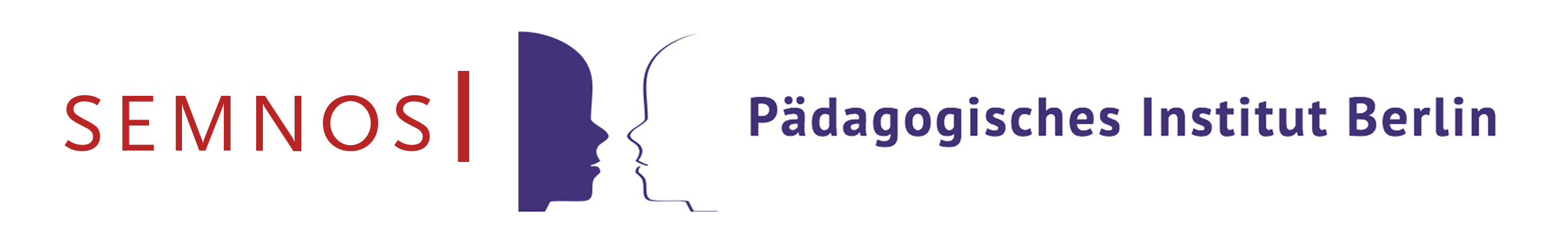Veraltete, bis heute in der Pädagogik dennoch weit verbreitete entwicklungspsychologische Vorstellungen
Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Vorstellung von einem Kind als bei seiner Geburt asozialem und triebgesteuerten Wesen vorherrschend. Diese Auffassung baute auf inzwischen widerlegten entwicklungspsychologischen Annahmen der 1920er und 1930er Jahre auf, orientierte sich bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts an entsprechenden Erziehungsvorstellungen aus dem Kaiserreich oder dem Nationalsozialismus, was sich in änderte, als die nach Kriegsende in Europa und den USA populärer werdende Psychoanalyse bzw. Verhaltenspsychologie auch für die Sozialwissenschaften immer bedeutender wurde. Aber auch diesen Ansätzen ist gemein, dass sich Kinder ohne entsprechende pädagogische Interventionen und Erziehungsmaximen zu Hause zu mehr oder weniger „a-sozialen“ Wesen entwickeln, solange ihnen keine Grenzen aufgezeigt werden.
In Einklang damit war es zentraler Bestandteil pädagogischer Institutionen, aus Kindern soziale Wesen zu machen, was jedoch nichts anderes hieß, als sie dem unter den Erwachsenen gerade herrschenden sozialen Kodex anzupassen. Da sie dazu von Natur aus aber nicht freiwillig bereit seien, müsse man ihnen „soziales Verhalten“ mit Autorität und Zwang beibringen, man kann auch sagen, ihren apriori anarchischen Willen brechen. Gemäß dieser Logik lag die Schuld des Kindes, wenn es sein Verhalten nicht den Wünschen und Vorstellungen der Erwachsenen unterwarf, ausschließlich bei ihm. Nachdem die körperliche Bestrafung von Kindern gesellschaftlich ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zunehmend geächtet wurde, wurde bis heute das Erzeugen von Schuldgefühlen zum Mittel der Wahl, um eine Verhaltensänderung des Kindes zu erreichen, und dies sowohl als erzieherische als auch als pädagogische Maßnahme. Auch hier griff und greift die Logik, dass alles, was das Kind abweichend von den Vorstellungen der Erwachsenen (und Lehrer!) tut, ausschließlich mit ihm zu tun hat. Die Handlungsmuster des Kindes wurden damit ins Kind verlagert (ungezogen, frech, faul, aufsässig, lethargisch, bequem, zappelig) und nicht im Zusammenhang mit seiner persönlichen Entwicklung auf der Beziehungsebene und den Reaktionen der Erwachsenen auf seine von Geburt an vorhandenen Handlungsintentionen gesehen. Auch heute werden die Kinder aus der Perspektive, für ihr Verhalten seien einzig sie selbst verantwortlich, sei es in Elternratgebern oder als fester Bestandteil didaktischer Maßnahmen, noch häufig zu Sündenböcken erklärt, nämlich die die alleinige Schuld an dysfunktionalen Prozessen in Elternhaus, Schule und Unterricht tragen.
Ein zweiter Ansatz, der Behaviorismus, der neben den psychoanalytischen Ansätzen in den 1960er Jahren zunehmend Eingang in die Entwicklungspsychologie des Kindes und pädagogische Handlungsanweisungen fand, sah das Kind als „black box“ oder „tabula rasa“, die es mittels Konditionierung und Verstärkung gewünschten Verhaltens zu füllen und formen galt. Dieses Konzept wies dem Kind in seinem Sozialisationsprozess letztlich eine passive Rolle zu und machte seine Bezugspersonen, seien es Eltern oder Lehrer, zu mächtigen Akteuren im Erziehungs- bzw. Bildungsprozess. Erstaunlich viele Elternratgeber und auch didaktische Vorstellungen von heute gehen noch auf diese wissenschaftlich längst überholte behavioristische Tradition zurück.
Alle besprochenen Ansätze eint, dass es sich bei der Erziehung oder Bildung des Kindes um einen Prozess handelt, der höchster Anstrengungen des Erwachsenen gegenüber dem Kind bedarf, dessen oft ursprünglichen Intentionen zuwiderläuft und dem Kind eine eher passive Rolle in Entwicklung und Lernen zuweist.
Dieses alte Paradigma befindet sich jedoch, auch wenn es weiterhin in vielen Köpfen herumspukt, mit der zunehmenden Auflösung einer „Gehorsamskultur“ (Juul & Jensen, 2012) in einer Krise. Im pädagogischen Raum sorgt dies für beträchtliche Unsicherheit und Hilflosigkeit. Aber als Alternative zu den hergebrachten Auffassungen lassen sich die neuen Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und in diesem Zusammenhang der Paradigmenwechsel, wie er sich aus der Beziehungsforschung der letzten drei Jahrzehnte ergibt, auch für Pädagogen gut nutzen (Jensen&Jensen 2013).
Die Ergebnisse der neuen Beziehungsforschung: das Kind als soziales Wesen
Heute wissen wir, dass das Kind dazu imstande ist, von Geburt an eine Subjekt-Subjekt-Beziehung (Schibbye 2005) zu seinen nächsten Bezugspersonen einzugehen. Es wird sozial kompetent und nicht nur als passiv empfangend in die Beziehung zwischen sich und der Welt hineingeboren, als ein Individuum, das von Anfang an mit seinen Verhaltensweisen auf die Handlungen der Eltern versucht einzuwirken und damit die Beziehung aktiv mitprägt. Und umgekehrt wird dieses Kind nachhaltig von seinen ersten und wichtigsten Bezugspersonen mit der Art, wie sie es empfangen und auf es eingehen, nachhaltig beeinflusst. Schon früh prägen sie seine „Weltsicht“. Dabei handelt es sich um einen wechselseitigen Prozess, der zunächst in Gesten und spontanen Reaktionen, später in Worten und immer komplexeren Handlungsmustern vom Kind zum Erwachsenen und vom Erwachsenen zum Kind verläuft. Neuropsychologische Forschungsergebnisse zeigen, dass dies auch für den Aufbau und die Entwicklung von komplizierten neurologischen Strukturen im Gehirn gilt, die mit allen anderen Entwicklungsbereichen zu tun haben.
Dies ist der Kern im Paradigmenwechsel der modernen Entwicklungspsychologie. Er sieht das Kind von Anfang an als ein in Beziehungszusammenhängen denkendes und handelndes Subjekt, woraus sich ein ganz anderes Verständnis für erzieherische und pädagogische Interventionen herleiten lassen.
Auch die vom Briten John Bowlby in der 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse begründete Bindungstheorie zeigt, dass Kinder sich von Geburt an in Beziehung zu ihren ersten Bezugspersonen setzen müssen, um sich altersgemäß entwickeln zu können. Wenn dies zunächst auch aus dem bloßen Willen heraus geschieht, zu überleben, dient das Verhalten des Kindes schon nach zwei bis drei Lebensmonaten dem Ziel, sich über eine feste Bindungsperson soziale Resonanz zu sichern. Viele empirische Untersuchungen zeigen, dass das Ausbleiben solcherart Resonanz bei Kindern zu schwersten psychischen Störungen bis hin zum Tod führen.
Der Entwicklungsprozess von Kindern findet also immer in Beziehungen statt. Dies gilt nicht nur für ihre frühe Kindheit, sondern das gesamte Heranwachsen hindurch, genau wie es auch erwachsene Menschen brauchen, sich zu anderen Menschen in Beziehung zu setzen, um sich immer weiter entwickeln zu können.
Resonanzprozesse und ihre Wirkung im pädagogischen Raum
Als besonders wichtig auch in Hinblick auf pädagogische Prozesse folgt aus dem angesprochenen Paradigmenwechsel, das Kind als von seiner Geburt an soziales Wesen zu sehen, dass es sein Handeln nicht nur als wirksam, sondern auch als wertvoll inszeniert, indem es beabsichtigt, darüber eine entsprechend positive Resonanz beim Gegenüber zu erzeugen („der/die andere mag mich, deshalb geht sie/ er auf mich ein“). Ängste, dass das eigene Handeln zu Nichtbeachtung („ich bin nicht wirksam“ oder zu Tadel oder Bestrafung („mein Verhalten ist nicht wertvoll“) führt, blockieren selbstständige Handlungs- und Lernprozesse des Kindes und provozieren auffällige Verhaltensweisen.
In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer, für pädagogische Prozesse zentraler Gesichtspunkt zu betrachten, nämlich der seit seiner Geburt unbedingte Wille des Kindes zur Kooperation und den daraus entstehenden innerpsychischen Konflikten, wenn es dem Kind an Resonanz und Beachtung mangelt. (Jensen&Jensen 2013)
Ein Kind hat das existenzielle Bedürfnis zusammenzuarbeiten, um sich positiv zu entwickeln. Quasi instinktiv weiß das Neugeborene, dass es kooperieren muss, nicht nur, um zu überleben, sondern auch, um in die soziale Gemeinschaft, die es umgibt, aufgenommen zu werden. Die empirisch vielfach bestätigte Auffassung, dass Kinder von Anfang an sozial kompetent sind und kooperieren wollen, impliziert also, dass Kinder zunächst bestrebt sind, immer nur ihr Bestes tun, um mit ihrer Umgebung zusammenzuarbeiten!
Nimmt die Umgebung des Kindes dieses Angebot an, reagiert entsprechend emphatisch und feinfühlig, entsteht daraus ein auf gegenseitiger Anerkennung beruhender wechselseitiger Prozess von Lernen und Entwicklung – eine für alle förderliche und fruchtbare Resonanzbeziehung.
Das Bedürfnis des Kindes, immer sein Bestes zu geben, um sich in der Beziehung zum nahen Erwachsenen wertvoll zu fühlen bedeutet leider aber auch, dass es versucht, mit jeder Form von erwachsenem Verhalten zusammenzuarbeiten, egal ob es für sein eigenes Leben konstruktiv oder destruktiv ist. Ist letzteres der Fall, gerät das Kind in einen Konflikt, sowohl sein existenzielles Bedürfnis nach Anerkennung zu befriedigen wie auch seine persönliche Integrität zu wahren. Das kann zum einen darauf hinauslaufen, dass es sich in solchen Situationen, in denen es sein Verhalten nur danach ausrichtet, „um zu gefallen“, immer mehr anstrengen muss, wenn die Anerkennung von außen ausbleibt – es passt sich noch mehr an, bis sein eigenes Ich förmlich erlischt und die Kraft nicht mehr vorhanden ist, die Situation zu steuern. Oder es geht den umgekehrten Weg und versucht auf den inneren Konflikt, der es bewegt, aufmerksam zu machen, indem es sich wehrt – und zwar durch sozial auffälliges Verhalten jedweder Art. Dass dieses Verhalten versucht, die existenzielle Integrität des Kindes zu wahren und sie – für Außenstehende auf sicherlich keine angenehme Weise – aufrechtzuerhalten ist ein wertvolles Instrument auch im pädagogischen Prozess und muss vor jeder pädagogischen Intervention anerkannt werden.
Die meisten Störungen des Verhaltens, der Konzentration und der Aufmerksamkeit von Kindern und Jugendlichen haben somit ihre Wurzeln in frühkindlichem Beziehungsverhalten, das sich auf die Beziehungen, in denen sie sich gerade befinden, überträgt. Natürlich spielen dabei die Beziehungen zu den Eltern eine entscheidende Rolle. Das ist unter Lehrern und Erziehern seit Langem allgemein anerkannt, führt allerdings auch dazu, eigene Anstrengungen zu unterlassen. Schwieriger ist es, mit der Erkenntnis zu leben, dass die Beziehung des Kindes zum Lehrer in vielerlei Hinsicht ähnliche Muster aufweist wie die Beziehung zwischen Kind und seinen Eltern. In beiden Fällen haben wir es mit einer asymmetrischen Beziehung zu tun, der ein Macht- und damit Abhängigkeitsverhältnis zugrunde liegt, in beiden Fällen spielen Zuneigung und der Wunsch, bestätigt zu werden und damit die Angst vor Ungerechtigkeit eine wichtige Rolle und ebenso der Wunsch, sich sicher und geborgen zu fühlen.
Lehrer und Lehrerinnen brauchen Beziehungskompetenz
Schule und Unterricht beruhen in vielerlei Hinsicht auf Beziehungs- und Bindungsprozessen – eine Tatsache, die bis heute in Erziehungswissenschaft und Pädagogik sträflich vernachlässigt wird, obwohl sie doch auf der Hand liegt. Wenn wir also tatsächlich unser Wissen darüber, dass die Subjekt-Subjekt-Beziehung von Geburt des Kindes an die Basis für Lernen und Entwicklung ist, umsetzen wollen, müssen wir auf die Bedeutung und die Rolle des Pädagogen im Beziehungsgeschehen in der Schule zu sprechen kommen. Das aber bedeutet auch, dass bei allen anfallenden Schulproblemen, ob sie mit dem Lernen des Kindes oder seinem Verhalten zu tun haben, der Fokus auf der Beziehung und nicht mehr auf dem Verhalten des Kindes liegen sollte. Fokussiert die Lehrerin oder der Lehrer nach wie vor nur das auffällige Verhalten der Schülerin oder des Schülers und sieht in diesem nicht den Versuch des Kindes, sein existenzielles Bedürfnis nach Integrität zu wahren (Juul &Jensen 2012), kann das tatsächlich existierende Problem kaum gelöst werden. Dazu gehört aber auch, den eigenen Anteil an dem Problem im Resonanzprozess zwischen sich und dem Kind zu verstehen. Denn in der Beziehung zum Kind trägt nun mal der Pädagoge als Erwachsener Hauptverantwortung für die Qualität der Beziehung und deswegen befindet sich der Schlüssel bei ihm, die Beziehung für beide Seiten konstruktiv zu verändern. Dies macht aus dem Kind keinesfalls eine Art von „Befehlsempfänger“, sondern bezieht es im Gegenteil von Anfang an in den Prozess gegenseitigen Verstehens und Veränderns mit ein.
Der Wille des Pädagogen, die Verantwortung für die Qualität der Beziehung zu übernehmen, muss aus dem Wissen über die Bedeutung der Beziehung und den Paradigmenwechsel in der Entwicklungspsychologie erwachsen. Das bedeutet, dass Kindern als den sozial kompetenten Menschen begegnet werden sollte, die sie sind. Diese soziale Kompetenz zeigt sich am Anfang primär in den starken, grundlegenden Bedürfnissen der Kinder, sich in den nahen Beziehungen wertvoll zu fühlen, und weiter in dem Drang zur Zusammenarbeit mit ihrem persönlichen Umfeld.
Schon wenn die Kinder in die Schule kommen, bringen sie einen entsprechenden „Beziehungs-Erfahrungsschatz“ mit ein, und dieser prägt die Art und Weise, wie sie ihrer Umwelt begegnen. Kinder, die vorwiegend in Beziehungen leben oder gelebt haben, die destruktiv für ihre Entwicklung sind oder waren, haben oft mehr Probleme damit, Beziehungen mit anderen einzugehen, und es erfordert die Bereitschaft vom Pädagogen, mit diesen Kindern in eine Beziehung zu treten. Die mangelnde Fähigkeit des Erwachsenen diesbezüglich darf nicht auf die Kinder übertragen werden, indem man sie als verhaltensschwierig, unerzogen oder egozentrisch abstempelt.
Zur Beziehungskompetenz des Pädagogen zählt besonders, nicht vorschnell auf das Verhalten des Kindes zu reagieren, sondern sich Zeit zu lassen und sich in Geduld zu üben, um sich in das Kind einfühlen zu können, seine Sicht der Dinge herauszuarbeiten, zu erkennen und zu respektieren. Eine solche „emphatische Einstellung“ ist jedoch auch von den Begegnungen abhängig, die die Lehrerin oder der Lehrer ihrem oder seinem Leben selbst geprägt haben – ob sie überwiegend als die, die sie sind, »gesehen« wurden und dementsprechend Anerkennung und Respekt erhalten haben, oder ob ihnen diese Qualitäten, die später über die eigenen Ressourcen bestimmen, einer Beziehung vorenthalten wurden.
Diese Einsicht in das „eigene Ich“ hilft auch dabei, dass man als Pädagogin/Pädagoge sein Verhalten auf das abstimmen kann, was man hinter dem offensichtlichen Verhalten des Kindes erkennt, und Schülern dementsprechend mit Führungswillen und Authentizität begegnen kann. Etwas vereinfacht gesagt zeigt sich das oft an der Frage, ob man glaubt, Schüler seien in erster Linie lästig, weil nicht steuerbar. Je mehr wir über die interpsychischen und interpersonellen Mechanismen wissen, die in zwischenmenschlichen Beziehungen vorkommen, darunter auch unsere eigenen Reaktionen, desto besser sind wir dazu imstande, anderen auch in Konfliktsituationen mit authentischer Anwesenheit zu begegnen.
Das Tabu
Trotz des Paradigmenwechsels, also Kinder von Beginn an als soziale Wesen anzuerkennen, und trotz des Verständnisses, welche Bedeutung daraus den Beziehungen im Rahmen der kindlichen Entwicklung zukommt, braucht es natürlich Zeit, entsprechendes Wissen in die Praxis umzusetzen, insbesondere weil vielfach weiterhin so getan wird, als ob die persönliche Disposition des Pädagogen, seine persönlichen Ressourcen und Reaktionen für die Qualität der Beziehung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die meisten wissen natürlich, dass diese Qualitäten Bedeutung haben, aber sie halten es noch immer für ein Tabu, über ihre eigene Rolle im Unterrichtsprozess zu sprechen und an ihr zu arbeiten. Dieses Tabu muss gebrochen werden um gängige Narrative vom „schlechten Schüler“ bzw. „schlechten Lehrer“ mit den damit verbundenen Schuldvorwürfen, zu befreien. Immer noch ist das Richtig-Falsch-Denken in der Welt der Schulen weit verbreitet und damit die Tendenz, für alles einen Sündenbock zu finden: »Hätte ich doch eine andere Klasse. Wenn der M. nicht in der Klasse wäre und ständig stören würde, wäre es viel einfacher. Wenn die Eltern nicht so viel Druck machen würden.“ Alle diese Aussagen sind nicht unbedingt falsch, aber sie führen zu keiner Lösung.
Kultur des Umgangs
Die Beziehungskompetenz des Lehrers setzt eine Kultur des Umgangs voraus, die es ermöglicht, seine verwundbaren Seiten zu zeigen, ohne zu Schaden zu kommen, und in der man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann, ohne unangebrachter Nabelschau beschuldigt zu werden. Hier ist besonders die Leitung, aber auch die kollegiale Gemeinschaft von großer Bedeutung. In der Lehrerausbildung und in der Schule selbst ist es nicht Tradition, die Schwachstellen in der eigenen Entwicklung zum Thema zu machen. Man wird vornehmlich ausgebildet und später angestellt, um einen Job zu erledigen, und sollte statt Unsicherheit über die eigene Rolle am besten zeigen, dass man ihn beherrscht. Vielleicht ist die Tatsache, dass der Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns kaum oder gar keine Zeit eingeräumt wird, die zurzeit größte Schwachstelle in der derzeitigen Ausbildung zum Pädagogen.
Quellen und Literatur:
Dornes, Martin: Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen. Frankfurt a. M. : Fischer 1993
Greenspan, Stanley I., Shanker, Stuart G.: Der erste Gedanke. Frühkindliche Kommunikation und die Evolution menschlichen Denkens. Weinheim und Basel: Beltz 2007
Jensen, Elsebeth, Jensen Helle: Professionelt forældresamarbeijde. Akademisk Forlag 2013 (dt.: Gelungene Lehrer-Eltern-Gespräche. Weinheim und Basel: Beltz 2016 (im Druck)
Juul, Jesper, Jensen, Helle: Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für eine neue Erziehungskultur. Weinheim und Basel: Beltz 2012
Schibbye, Anne-Lise, Løvlie: Relationer. Akademisk Forlag 2005
Stern, William: Psychologie der frühen Kindheit, bis zum sechsten Lebensjahre. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Leipzig 1993