Ausgangspunkt
Kinder werden mit sozialen Kompetenzen geboren und haben von Geburt an das existenzielle Bedürfnis, mit anderen eine Bindung und dafür Beziehungen einzugehen. Für ihre gesunde körperliche und psychische Entwicklung ist es notwendig, dass ihre nächsten Bezugspersonen auf ihren Beziehungswunsch fürsorglich mit Gesten und Worten eingehen, und sich auf diese Weise zwischen Mutter/Vater und Kind ein ursprüngliches Resonanzverhältnis herstellt, das beim Kind zu einer Art Urvertrauen in sich selbst und seine Umgebung führt. Um sich in diesem Resonanzverhältnis als wertvoll und anerkannt zu fühlen, suchen die Kinder immer wieder den Kontakt mit den Erwachsenen in der Hoffnung auf ein liebevolles und positives Feedback ihres Verhaltens und sind hierfür von Geburt an bereit zur Kooperation. Verhaltensauffälligkeiten, die Kinder in Schule und Unterricht zu herausfordernden Schülern werden lassen, beruhen zum großen Teil auf einer Störung solcherart Beziehungsdynamik, sich angenommen, respektiert, wertvoll und anerkannt zu fühlen. Zumeist liegt ihnen eine Beziehungsstörung zugrunde, deren Ursprung in der frühen Bindungsgeschichte des Kindes zu suchen ist. Im Schul- und Unterrichtsgeschehen leben solche Beziehungsstörungen wieder auf, da die Dynamik der Beziehung zwischen Kind und Lehrerin bzw. Lehrer der zwischen Kind und Eltern in mancherlei Hinsicht nicht unähnlich ist. In beiden Fällen haben wir es mit einer asymmetrischen Beziehung zu tun, der ein Macht- und Abhängigkeitsverhältnis zugrunde liegt. In beiden Beziehungen spielen – übrigens nicht nur bei den jüngeren Schülern – Zuneigung und der Wunsch, bestätigt zu werden und damit die Angst vor ungerechter Behandlung eine bedeutende Rolle; hinzukommt, insbesondere bei den jüngeren Schülern, das Bedürfnis, sich auch in der Schule sicher und geborgen zu fühlen.
Anhaltende und tiefgreifende Störungen im Unterricht lassen sich deswegen dauerhaft nicht „technisch“ (durch Strafen, Notengebung, Sitzordnung etc.) beheben, zumal das auffällige Verhalten des Kindes ja „unter verkehrtem Vorzeichen“ durchaus sinnvoll ist, indem es seinem Wunsch entspricht, Vertrauen geschenkt zu bekommen, beachtet zu werden, Resonanz herzustellen und zu kooperieren, auch wenn sein Verhalten diesem Ziel äußerlich scheinbar entgegensteht. Disziplinarische Mittel mit dem Ziel, das Verhalten des Schülers zu verändern, bedrohen ihn zusätzlich in ihrer oder seiner Integrität (Juul/Jensen 2012) und verstärken in den meisten Fällen nach kurzfristigen Erfolgen sein auffälliges Verhalten. Diese auf den ersten Blick nicht immer zu erkennende Beziehungsdynamik gilt es im Umgang mit herausfordernden Schülern zu berücksichtigen.
Bindung, Bildung, Lernen und Unterricht
Bindung und Bildung gehören in der Tradition der akademischen Psychologie und Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft nicht zusammen, zumal es zwischen beiden Disziplinen nur selten oder gar nicht zu einem fachlichen Austausch kommt. Das behindert bis heute unser Verständnis von den emotionalen Prozessen, wie sie sich auf der Beziehungsebene zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen abspielen und die interessiertes, aufmerksames und erfolgreiches Lernen ermöglichen. Wenn Psychologie Eingang in die Lehrerausbildung findet, dann meistens unter dem Gesichtspunkt der Motivationspsychologie, die einen widerspenstigen Schüler quasi implizit voraussetzt.
Bindungstheoretische Überlegungen zu erfolgreichem Lernen bzw. Störungen im Lernprozess des Einzelnen hingegen berücksichtigen besonders die existenziellen Bedürfnisse von Kindern, wie das Bedürfnis nach Anerkennung, Kooperation und Resonanz als Grundlage für jede Art von menschlichem Lernen. In dieser Hinsicht wird, wie zahlreiche empirische Studien belegen, das Lernen nachweislich sowohl durch positive, aber auch durch unzureichende Bindungserfahrungen der Kinder im Elternhaus und in der Schule gefördert bzw. beeinträchtigt.
Empirische Studien zeigen, dass gute Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit das Selbstvertrauen des Kindes in seine eigenen Fähigkeiten (Selbstwirksamkeit) stärken und einen feinfühligen sozialen Umgang mit Mitschülern fördern (Grossmann und Grossmann 2008). Beim Lernen haben sie keine Angst, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben, ihre Beziehung zum Lehrer/zur Lehrerin ist zu Beginn ihrer Schulzeit meistens positiv gestimmt, Zurückweisung, wie sie in der Schule unvermeidbar ist, und Enttäuschungen können sie gut verkraften. Kinder mit unsicheren oder ambivalenten Bindungserfahrungen hingegen suchen häufig übertrieben nach Bindung zur Lehrerin oder zum Lehrer und wenden sich enttäuscht oder wütend ab, wenn ihre Suche nach Resonanz nicht belohnt wird. Zurückweisung löst bei ihnen häufig heftige Gefühle aus, sowohl aggressives Verhalten aber auch kompletten Rückzug vom Unterrichtsgeschehen. Beim Lernen zeigen sie häufig Angst, sich auf neues, d.h. unsicheres Terrain zu begeben, und sie leiden besonders unter disziplinarischen Maßnahmen und schlechter Benotung, weil sie diese als Angriff auf ihre ganze Person empfinden und weniger auf ein bestimmtes Verhalten.
Der renommierte Bindungsforscher Karl Heinz Brisch schätzt anhand von empirischen Untersuchungen, dass etwa 60 Prozent aller Menschen aus ihrer Kindheit eine sichere Bindung mitbringen, etwa 30% unsichere Bindungserfahrungen hatten und etwa 10% schwere Bindungsstörungen zeigen – Auftretenshäufigkeiten, die sich entsprechend auch in der Schule zeigen – im Übrigen auf beiden Seiten, sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern.
Obwohl das Bindungsgeschehen also auf Verhalten und Lernprozesse einen großen Einfluss hat, ist das heutige Schulsystem – vielleicht mit Ausnahme der ersten Grundschulklassen – überwiegend bindungsvermeidend organisiert. Überfüllte Klassenräume, hierarchische Strukturen, der erzwungene Gleichschritt im Lernen und eine permanente Bedrohung durch schlechte Noten verstärken besonders die negativen Bindungserfahrungen von Kindern, was bei ihnen, den bindungsunsicheren Kindern, zu Interesselosigkeit und Apathie, aber ebenso zu Verhaltensauffälligkeiten führt, die meistens dazu dienen, mit unterschiedlichen Mitteln die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Führt solches Verhalten dann zu keinem Erfolg oder wird bestraft, gerät das Kind durch die erneute Erfahrung, nicht akzeptiert, nicht „wertvoll“ zu sein, in einen Teufelskreis, aus dem es allein nicht mehr herausfinden kann. Lehrerinnen und Lehrer stehen der ihnen jetzt zufallenden Aufgabe, dem Kind aus diesem Teufelskreis herauszuhelfen, oft hilflos gegenüber, weil in der Lehrerausbildung trotz mancher zaghaften Anfänge das Verständnis für strukturelle Eigenheiten von Beziehungen sowohl auf Seiten der Schüler wie auf Seiten des Lehrers, aus dem traditionellen didaktischen Dreieck herausgehalten werden. Dieses wird zumeist so definiert, dass es im Unterricht hauptsächlich um die Sache, also die Beziehung aller Beteiligten zum Lerngegenstand geht, ein Prozess, der die Beziehungsebene zwischen den verschiedenen, beteiligten oder nicht beteiligten Akteuren in diesem Geschehen oft komplett ausblendet. Der Soziologe Hartmut Rosa stellt in diesem Zusammenhang einem „Resonanzdreieck“, in dem der Lehrer seine Schüler erreicht, ein „Entfremdungsdreieck“ gegenüber, in welchem der Lehrer den Schüler eher als Bedrohung empfindet und sich der Schüler dem Lernstoff gegenüber völlig indifferent verhält.
Paradigmenwechsel: Das Kind als soziales Wesen
Bis weit in die 70er Jahre des letzten Jahrzehnts war die Vorstellung von einem Kind als bei seiner Geburt asozialem und triebgesteuerten Wesen vorherrschend, eine Auffassung, die besonders durch die Wiederentdeckung der Psychoanalyse neue Nahrung erhielt. Ein zweiter Ansatz, der Behaviorismus, sah das Kind eher als „black box“, die es mithilfe von Konditionierung und Verstärkung zu füllen und formen galt. Beiden Konzepten ist eigen, dass sie den Auftrag pädagogischer Institutionen vor allem darin sehen, aus Kindern soziale Wesen zu machen. Gemäß dieser Logik, die sich in populären Konzepten und mancher didaktischen Handreichung bis heute gehalten hat, liegt der Ursprung sozial abweichender Handlungsmuster beim Kind. Damit werden Eltern und Lehrer/innen zu mächtigen Akteuren im Erziehungs- und Bildungsprozess, kommt ihnen doch die Rolle zu, die Kinder dem Sozialkodex der Erwachsenen anzupassen. Erstaunlich viele Vorstellungen gehen bis heute noch auf diese wissenschaftlich längst überholte Sichtweise zurück. Andererseits aber befindet sich derzeit dieses alte Paradigma mit der zunehmenden Auflösung einer „Gehorsamskultur“ in einer Krise (Juul/Jensen 2012). In pädagogischen Institutionen sorgt dies für zunehmende Unsicherheit und auch Hilflosigkeit. Als Alternative zu den hergebrachten Auffassungen lassen sich die neuen Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, wie sie sich aus der Bindungstheorie und Beziehungsforschung in den letzten drei Jahrzehnten ergeben haben, aber für Lehrer und Lehrerinnen gut nutzen.
Das Kind als von Anfang an auf wechselseitigen Austausch mit seinen Bezugspersonen hin motiviertes soziales Wesen – dies ist der Kern des Paradigmenwechsels in der Entwicklungspsychologie. Damit aber wird der Entwicklungsprozess von Kindern in hohem Maße von der – guten oder schlechten – Qualität solcher reziproken Beziehungen abhängig, denn davon, und das lassen Resonanzkonzepte häufig unberücksichtigt, hängt seine Resonanzfähigkeit ab. Dass eine solche Sicht einen ganz anderen erzieherischen und pädagogischen Einsatz erfordert, liegt auf der Hand.
Resonanzprozesse und ihre Wirkung im pädagogischen Raum
Als besonders wichtig in Hinblick auf pädagogische Prozesse folgt aus dem angesprochenen Paradigmenwechsel, dass das Kind sein soziales Handeln nicht nur einfach als wirksam, sondern auch als wertvoll inszeniert, indem es beabsichtigt, darüber eine entsprechend positive Resonanz beim Gegenüber zu erzeugen („der/die andere mag mich, deshalb geht sie/er auf mich ein“). Ängste, dass das eigene Handeln zu Nichtbeachtung („ich bin nicht wirksam“ oder zu Tadel oder Bestrafung („mein Verhalten ist nicht wertvoll“) führt, blockieren selbstständige Handlungs- und Lernprozesse des Kindes und provozieren auffällige Verhaltensweisen.
In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer, für pädagogische Prozesse zentraler und bereits angesprochener Gesichtspunkt zu betrachten, nämlich der seit der Geburt des Kindes unbedingte Wille des Kindes zur Kooperation und den daraus entstehenden innerpsychischen Konflikten, wenn es dem Kind an Resonanz und Beachtung mangelt.
Ein Kind hat das existenzielle Bedürfnis zusammenzuarbeiten, um sich positiv zu entwickeln. Quasi instinktiv weiß das Neugeborene, dass es kooperieren muss, nicht nur, um zu überleben, sondern auch, um in die soziale Gemeinschaft, die es umgibt, aufgenommen zu werden. Die empirisch vielfach bestätigte Auffassung, dass Kinder von Anfang an sozial kompetent sind und kooperieren wollen, impliziert also, dass Kinder zunächst bestrebt sind, immer nur ihr Bestes tun, um mit ihrer Umgebung zusammenzuarbeiten!
Nimmt die Umgebung des Kindes dieses Angebot an, reagiert entsprechend emphatisch und feinfühlig, entsteht daraus ein auf gegenseitiger Anerkennung beruhender wechselseitiger Prozess von Lernen und Entwicklung – eine für alle förderliche und fruchtbare Resonanzbeziehung.
Das Bedürfnis des Kindes, immer sein Bestes zu geben, um sich in der Beziehung zum nahen Erwachsenen wertvoll zu fühlen bedeutet leider aber auch, dass es versucht, mit jeder Form von erwachsenem Verhalten zusammenzuarbeiten, egal ob es für sein eigenes Leben konstruktiv oder destruktiv ist. Ist letzteres der Fall, gerät das Kind in einen Konflikt, sowohl sein existenzielles Bedürfnis nach Anerkennung zu befriedigen wie auch seine persönliche Integrität zu wahren. Das kann zum einen darauf hinauslaufen, dass es sich in solchen Situationen, in denen es sein Verhalten nur danach ausrichtet, „um zu gefallen“, immer mehr anstrengen muss, wenn die Anerkennung von außen ausbleibt – es passt sich noch mehr an, bis sein eigenes Ich förmlich erlischt und die Kraft nicht mehr vorhanden ist, die Situation zu steuern. Oder es geht den umgekehrten Weg und versucht auf den inneren Konflikt, der es bewegt, aufmerksam zu machen, indem es sich wehrt – und zwar durch sozial auffälliges Verhalten jedweder Art. Dieses Verhalten ist insofern sinnvoll, als das Kind versucht, seine existenzielle Integrität zu wahren, mit anderen Worten darauf aufmerksam macht, dass es sich in seiner Identität bedroht fühlt.
Die meisten Störungen des Verhaltens, der Konzentration und der Aufmerksamkeit von Kindern haben somit ihre Wurzeln in frühkindlichen Beziehungen, die in der Schule wieder aufleben. Denn im Unterricht spielen im Rahmen der Wissensvermittlung Anerkennung (nicht zu verwechseln mit Lob), Akzeptanz, Achtung der Integrität des Schülers, das Gefühl des “Angenommenseins“ etc. eine wesentliche Rolle – übrigens „auf beiden Seiten“!
Herausfordernde Schüler aus bindungstheoretischer Sicht
Nach verschiedenen empirischen Studien weisen etwa ein Fünftel der Schüler psychische Auffälligkeiten auf. Obwohl die im Unterricht herausfordernden Kinder oft nur eine Minderheit unter den Schülern ausmachen, nehmen sie dennoch einen sehr großen Teil der Aufmerksamkeit der Pädagogin und des Pädagogen in Anspruch. Man könnte auch von „anstrengenden“,“ „störenden“, „unerzogenen“ Kindern sprechen oder von Kindern mit sozialen Problemen, Lernstörungen, Auffälligkeiten usw. – wir bevorzugen den von Juul und Jensen benutzten Begriff „herausfordernde Kinder“ (Juul/Jensen 2012), weil er ein beziehungsmäßiges Phänomen beschreibt, statt Kinder nach ihrem Verhalten zu kategorisieren und stigmatisieren.
Herausfordernde Kinder haben Schwierigkeiten, ihre Probleme so mitzuteilen, dass sie der andere versteht. Oft aus Schuld- und Schamgefühlen, häufig aber auch, weil sie in destruktive Prozesse mit ihren nächsten Bezugspersonen verwickelt sind, die sie aus Liebe und Loyalität nicht „verraten“ wollen. Auch äußere Ereignisse können über ein Kind „hereinbrechen“ und es fühlt sich unfähig, darüber zu sprechen, sei es Trennung der Eltern, der Tod eines nahestehenden Verwandten, der Wegzug eines Freundes etc. Allerdings zeigen die Kinder häufig über ihr Beziehungsverhalten, zu dem sämtliche Ausdrucksmöglichkeiten von Gesten, Bewegungen bis zu sprachlichem Ausdruck zählen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Unruhe, Konzentrationsmängel, Rückzug, Aggression, Streitlust, ständige Suche nach Aufmerksamkeit, Beleidigungen, Mobbing usw. dienen dazu, auf sich und das Problem, das unausgesprochen bleibt, hinzuweisen. In diesem Sinne ist ihr Verhalten also durchaus sinnvoll.
Es ist Aufgabe des Lehrers, einer solch fehlgeleiteten Kommunikationsform Sinn zu geben, indem er zunächst die Integrität des Schülers wahrt und seine „falsche“ Ausdrucksform nicht sofort „bekämpft“, sondern sie als an ihn gerichtete Botschaft des Kindes oder Jugendlichen interpretiert.
Lehrer und Lehrerinnen brauchen Beziehungskompetenz
In Schule und Unterricht spielen also in vielerlei Hinsicht Beziehungs- und Bindungsprozesse eine große Rolle, die es besonders im Umgang mit herausfordernden Schülern zu beachten gilt, eine Tatsache, die bis heute in Erziehungswissenschaft und Pädagogik sträflich vernachlässigt wird, obwohl sie doch, blickt man in jedes x-beliebige Klassenzimmer, auf der Hand liegt. Wenn wir also unser Wissen darüber ernst nehmen wollen, dass die Beziehungserfahrungen des Kindes mit seinen nächsten Bezugspersonen das Fundament für seine Entwicklung und sein Lernen bilden, folgt daraus, dass beim Umgang insbesondere mit herausfordernden Schülern der Fokus auf der Beziehung und nicht mehr auf dem Verhalten des Kindes liegen sollte. Fokussiert die Lehrerin oder der Lehrer nach wie vor nur das auffällige Verhalten der Schülerin oder des Schülers und sieht in diesem nicht den Versuch des Kindes, sein existenzielles Bedürfnis nach Integrität zu wahren, kann das tatsächlich existierende Problem kaum gelöst werden. Dazu gehört aber auch, den eigenen Anteil an dem Problem im Resonanzprozess zwischen sich und dem Kind zu verstehen zu wollen. In der Beziehung zum Kind trägt der Pädagoge als Erwachsener die Hauptverantwortung, bei ihm findet sich der Schlüssel, um die Beziehung zum Kind – für beide Seiten(!) – konstruktiv zu verändern. Dies macht aus dem Kind keinesfalls eine Art von „Befehlsempfänger“, sondern bezieht es im Gegenteil von Anfang an in den Prozess gegenseitigen Verstehens und Veränderns mit ein.
Dabei hilft, dass für manche der herausfordernden Schüler Lehrer die erste Erfahrung von stets anwesenden, zuverlässigen Erwachsenen sind, worin eine große Chance besteht, aber auch eine große Gefahr. Wiederholen sich im Umgang mit dem Schüler nämlich seine schädlichen frühkindlichen Beziehungsmuster, wie es im Schulalltag häufig vorkommt – zum Beispiel durch Ignoranz, Ablehnung oder Zurückweisung – wird sein auffälliges Verhalten dadurch eher verstärkt oder das Kind resigniert.
Zur Beziehungskompetenz des Pädagogen zählt also besonders, nicht vorschnell auf das Verhalten des Kindes zu reagieren, sondern sich Zeit zu lassen und sich in Geduld zu üben, um sich in das Kind einzufühlen, seine Sicht der Dinge herauszuarbeiten, zu erkennen und zu respektieren. Eine solche „emphatische Einstellung“ hat im Übrigen mit einer therapeutischen Intervention nichts zu tun. Im Grunde entspricht sie ganz einfach der Haltung, sich in den anderen hineinversetzen zu können, seine Integrität anzuerkennen und darüber mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dazu aber müssen wir auch mehr über unsere eigenen psychischen Mechanismen wissen, zum Beispiel, wie wir selbst auf Abwertung oder das Gefühl von Bedrohung reagieren, auch um gängige Narrative vom „schlechten Schüler“ bzw. „schlechten Lehrer“ mit den damit verbundenen Schuldvorwürfen, zu aufzulösen.
Für eine neue Kultur des Umgangs in der Schule
Die Beziehungskompetenz des Lehrers setzt eine Kultur des Umgangs voraus, die es ermöglicht, seine verwundbaren Seiten zu zeigen, ohne zu Schaden zu kommen, und in der man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann, ohne unangebrachter Nabelschau beschuldigt zu werden. Hier ist besonders die Leitung, aber auch die kollegiale Gemeinschaft von großer Bedeutung. In der Lehrerausbildung und in der Schule selbst ist es nicht Tradition, die Schwachstellen in der eigenen Entwicklung zum Thema zu machen. Man wird vornehmlich ausgebildet und später angestellt, um einen Job zu erledigen, und sollte statt Unsicherheit über die eigene Rolle am besten zeigen, dass man ihn beherrscht. Vielleicht ist die Tatsache, dass der Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns kaum oder gar keine Zeit eingeräumt wird, die zurzeit größte Schwachstelle in der derzeitigen Ausbildung zum Pädagogen. Der Beitrag auf dem Beltz Forum soll bei aller Notwendigkeit pragmatischen Handelns in Schule und Unterricht allen Mut machen, die Schule auch zu einem Ort authentischer, gegenseitiger Begegnungen werden zu lassen – und dies nicht nur im Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schüler.
Literatur:
Brisch, Karl Heinz: Die Bedeutung von Bindung im Lernprozess. www.qus-net.de/pdf_2011/Folien_Brisch_JT_2010.pdf
Dornes, Martin: Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen. Frankfurt a. M.: S. Fischer 1993
Grossmann,Karin/Grossmann, Klaus E.: Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit. Stuttgart: Klett Cotta 2008
Grossmann, Klaus E./Grossmann, Karin (Hrsg): Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie. Stuttgart: Klett-Cotta 2003
Grossman, Klaus E., Grossmann, Karin: Bindung und Bildung liga-kind.de/fruehe/606_grossmann.php
Juul, Jesper/Jensen, Helle: Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für eine neue Erziehungskultur. Weinheim und Basel: Beltz 2012
Koch, Claus: Bindung und Anderssein. Aspekte der Vulnerabilität im frühen Kindesalter. In: Andresen, S./Koch, C./König, J. : Vulnerable Kinder. Interdisziplinäre Annäherungen. Wiesbaden: Springer VS 2015
Rosa, Hartmut: Schule als Resonanzraum. Vortrag auf dem Kongress „Theater träumt Schule“, München, Februar 2015. DVD-Mitschnitt von Reinhard Kahl, unveröff.
Stern, William: Psychologie der frühen Kindheit, bis zum sechsten Lebensjahre. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Leipzig 1993
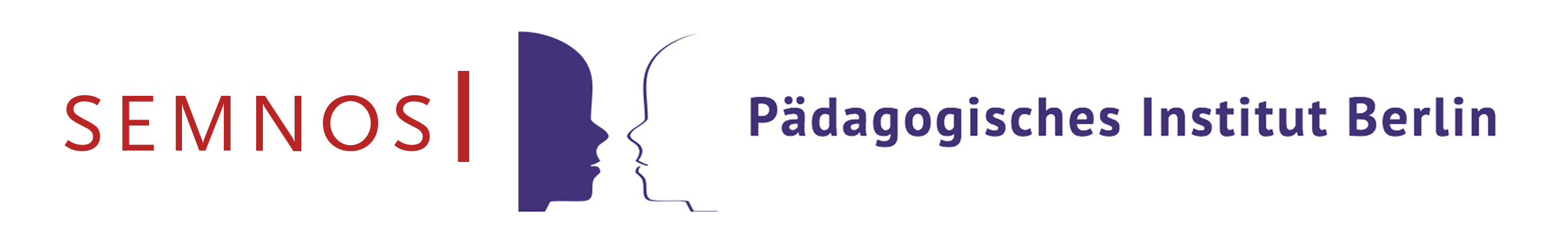
Pingback: Beziehungspädagogik braucht Teamarbeit - Kinder und Würde