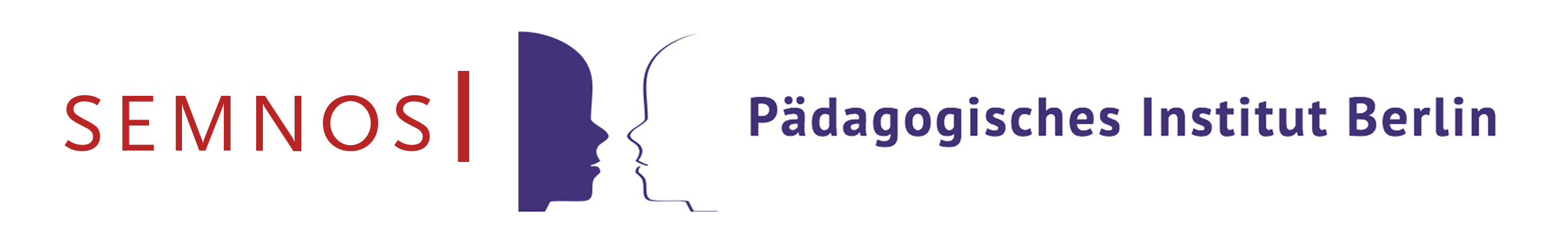Vor einigen Wochen erzählte mir jemand von einem interessanten Experiment. Im Rahmen einer pädagogischen Weiterbildung stellte die Kursleiterin den etwa fünfundzwanzig Teilnehmern folgende Fragen: Wer von Ihnen kann sich an zehn Lehrer erinnern, die in Ihrem Schulleben eine wichtige Rolle gespielt haben? Es folgte betretenes Schweigen. Wer von Ihnen denkt bei dieser Frage an etwa fünf solcher Lehrer – jetzt meldeten sich zwei Teilnehmer. Gibt es für Sie denn zwei Lehrer, an deren Unterricht Sie sich gerne erinnern? Jetzt hob schon die Hälfte der Anwesenden die Hand. Und wer erinnert sich an die eine Lehrerin oder den einen Lehrer, die oder der Ihnen in der Schule einmal „alles“ bedeutet hat? Fast fünfundzwanzig Finger schossen in die Höhe und befreites Lachen kam auf.
Im Folgenden soll es darum gehen, dem Ergebnis dieser Umfrage auf die Spur zu kommen. Dazu müssen wir uns aber zunächst auf eine Reise in unsere frühe Kindheit begeben.
Alle Kinder kommen mit sozialen Kompetenzen auf die Welt und haben von Geburt an das existenzielle Bedürfnis, mit ihren ersten Bezugspersonen eine Bindung und dafür Beziehungen einzugehen. Für ihre gesunde körperliche und psychische Entwicklung ist es dabei notwendig, dass diese Bezugspersonen, meistens die Eltern, auf ihren Beziehungswunsch fürsorglich mit Gesten und Worten eingehen, was beim Kind zu einer Art Urvertrauen in sich selbst und seine Umgebung führt. Das Baby lächelt zum Beispiel seine Mutter an und bekommt ein Lächeln zurück, es streckt seine Ärmchen aus und der Vater nähert sich seinem Gesicht und fragt, was es wolle. Das Kind deutet mit dem Finger auf einen Gegenstand und bekommt ihn von seiner Mutter. So lernt es von Geburt an, was Psychologen ein Gefühl von „Selbstwirksamkeit“ nennen: Ich kann mit dem, was ich zunächst mit meinen Gesten und später mit meinen Worten ausdrücke, in meiner Umgebung eine Wirkung erzielen. Mit zunehmenden Alter geht es dem Kind dann immer mehr darum, sich in dieser Beziehung auch wertvoll und anerkannt zu fühlen. Wobei das Gefühl, als die Person, die man ist, mit all ihren Stärken und Schwächen, Unsicherheiten und Fehlern anerkannt zu werden, etwas ganz anderes ist als das Lob für das, was man gerade geleistet hat.
Solche Überlegungen, die auf die von dem englischen Psychoanalytiker John Bowlby entwickelte Bindungstheorie zurückgehen, berücksichtigen also besonders die existenziellen Bedürfnisse von Kindern: das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung und nach Beziehung. Und genau diese Bedürfnisse sind es, die später auch bei jeder Art von Bildung eine große Rolle spielen. So belegen zahlreiche Studien, dass das Lernen in der Schule maßgeblich von positiven Bindungs- und Beziehungserfahrungen beeinflusst wird. Kinder mit Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben zum Beispiel keine Angst, sich beim Lernen auch auf unbekanntes Terrain zu begeben, Zurückweisung und Enttäuschungen, wie sie in der Schule unvermeidbar sind, können sie gut verkraften. Kinder, die in ihrer Kindheit keine so guten Bindungserfahrungen gemacht haben, die mit ihren Gesten und Worten oft nur auf wenig Gegenliebe stießen, suchen hingegen häufig übertrieben nach einer emotionalen Bindung zur Lehrerin oder zum Lehrer und wenden sich enttäuscht oder wütend ab, wenn ihre Suche nach Annahme und Bestätigung nicht belohnt wird. Sie leiden besonders unter disziplinarischen Maßnahmen und schlechter Benotung, weil sie beides als Angriff auf ihre ganze Person empfinden und weniger auf ein bestimmtes Verhalten.
Ich will dies an einem Beispiel noch einmal anschaulich machen. Zurückgewiesen werden gehört zu den Erfahrungen, die jedes Kind in seinem Leben macht, zunächst zu Hause, später in der Schule. Die Mutter muss zur Arbeit und kann auf den Beziehungswunsch des Kindes ebenso wenig eingehen wie der Lehrer auf den Wunsch jedes Kindes, immer aufgerufen zu werden. Aus bindungstheoretischer Sicht ist dabei nicht die Zurückweisung an sich das Problem, sondern in welchen Rahmen sie stattfindet. Wenn die Mutter das Kind in den Arm nimmt und ihm liebevoll sagt, „Es tut mir Leid, nicht mehr Zeit für dich zu haben, aber nun muss ich gehen“, oder der Lehrer dem Schüler, „Ich weiß, dass du mir zeigen willst, was du schon alles weißt, aber auch die anderen Kinder wollen doch einmal aufgerufen werden“, ist alles kein Problem. Das Kind fühlt sich beachtet, anerkannt und respektiert. Findet die Zurückweisung aber auf keiner positiven Beziehungsebene statt, sondern ohne jede Erklärung und schroff („Hör endlich auf, dich ständig zu melden, das stört!“), wird ein Kind zunächst dagegen rebellieren und bei weiteren ähnlichen Erfahrungen mit Interesselosigkeit für das, was es da lernen soll, reagieren.
Obwohl das Bindungsgeschehen erwiesenermaßen auf Bildung und Lernen einen großen Einfluss hat, ist das heutige Schulsystem – vielleicht mit Ausnahme der ersten Grundschulklassen – überwiegend bindungsvermeidend organisiert. Überfüllte Klassenräume und der erzwungene Gleichschritt im Lernen sowie eine permanente Bedrohung durch schlechte Noten sind allesamt beziehungsfeindlich. Dennoch leben im Schul- und Unterrichtsgeschehen Beziehungserfahrungen, die das Kind gemacht hat, immer wieder auf, was besonders damit zu tun hat, dass die Dynamik der Beziehung zwischen Kind und Lehrer der zwischen Kind und Eltern in mancherlei Hinsicht nicht unähnlich ist. In beiden Beziehungen spielt der Wunsch, bestätigt zu werden und damit die Angst vor ungerechter Behandlung eine bedeutende Rolle. Hinzukommt, insbesondere bei den jüngeren Schülern, das Bedürfnis, sich auch in der Schule sicher und geborgen zu fühlen.
Kommen wir zum Schluss des Artikels zu unserem kleinen Experiment vom Anfang zurück, dann wissen wir jetzt, dass sich die Erinnerung an den Lehrer und seinen Unterricht, den man nicht vergessen hat, genau der Erfahrung verdankt, die schon das kleine Kind in einem guten Bindungsverhältnis zu seinen Eltern macht: Sich in seinen existenziellen Bedürfnissen nach Anerkennung, Respekt, Wertschätzung angenommen und verstanden zu fühlen. Wir erinnern uns mit Freude vor allem an die Lehrer, bei denen wir das Gefühl hatten, dass sie uns beim Lernen so akzeptierten, wie wir waren, und uns nicht nur nach unseren Fehlern bewertet haben; die authentisch waren und manchmal ungewohnte Wege gingen, uns etwas beizubringen, egal, was der Lehrplan gerade vorschrieb. In der Literatur, in Lebensberichten oder in Filmen tauchen solche Lehrer im Übrigen immer wieder auf, besonders in Zusammenhang mit denen, die mit der Schule gar nicht oder nur schlecht zurechtkamen. So wie der Lehrer John Keating im bekannten Film „Der Club der toten Dichter“ den kleinen, schüchternen und in sich gekehrten Schüler Todd beibringt, wieder Vertrauen in sich selbst zu gewinnen.
Wir sollten die Rolle, die eine authentische Beziehung des Lehrers zum Schüler spielt, in der Lehrerausbildung stärker hervorheben, denn Lernen in einem beziehungsfreien Raum, oft genug verbunden mit Strafandrohungen, führt zu keiner Bildung, sondern lediglich zum Auswendiglernen und Vergessen. Mein Wunsch wäre, dass sich künftige Schülerinnen und Schüler später an mehr als einen oder zwei Lehrer erinnern, die für ihr Leben nach Schule eine bedeutende Rolle gespielt haben.