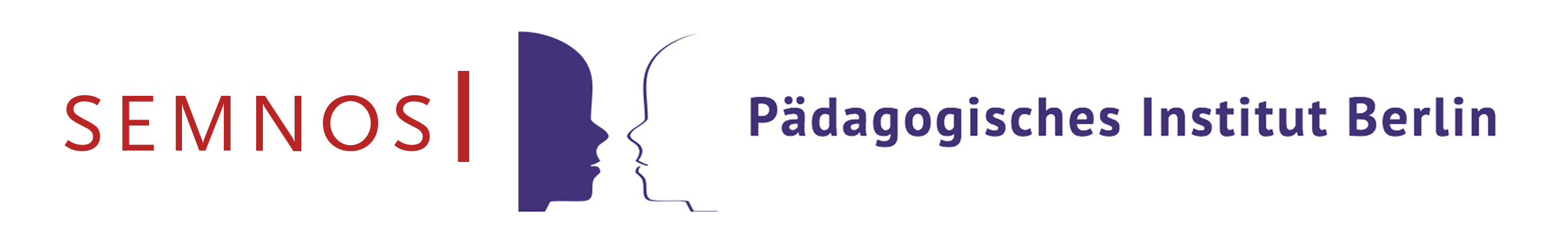Bindung und Bildung gehören in der Tradition der akademischen Psychologie und Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft nicht zusammen. Das behindert bis heute unser Verständnis über die biographischen Voraussetzungen, die interessiertes, aufmerksames und erfolgreiches Lernen ermöglichen. Bindungstheoretische Überlegungen berücksichtigen eher die existenziellen menschlichen Bedürfnisse von Kindern als Grundlage für jede Art von menschlichem Lernen – anders, als die immer noch übliche, oft technizistische, an älteren Konzepten des Behaviorismus orientierte Unterrichtsmethodik und Didaktik, die den Zusammenhang von Lernen und Bindungsprozessen unberücksichtigt lässt. Dabei wird, wie zahlreiche empirische Studien belegen, Bildung und Lernen nachweislich sowohl durch positive wie auch durch unzureichende Bindungserfahrungen der Kinder im Elternhaus und in der Schule gefördert bzw. beeinträchtigt, und ebenso spielen die Bindungserfahrungen der Lehrerin oder des Lehrers eine bedeutende Rolle beim Transfer von Wissen vom Lehrer zum Schüler. M.a.W.: Bindungsqualitäten, die in sozialen Austauschprozessen eine bedeutende Rolle spielen und die Qualität des sozialen Miteinander nachhaltig prägen sind – aus Sicht der Bindungsforschung – ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis von Lernprozessen in der Schule und beim Schüler. Oder, wie der Bindungsforscher Grossmann ausführt: „Bei Kindern gibt es keine engagierte Bildung ohne persönliche Bindung oder zumindest persönliche Anteilnahme. Wenn man Bildung will, muss man sich auf Bindungen einlassen. Wenn nicht zu Hause, dann in der Schule.“ (mehr …)