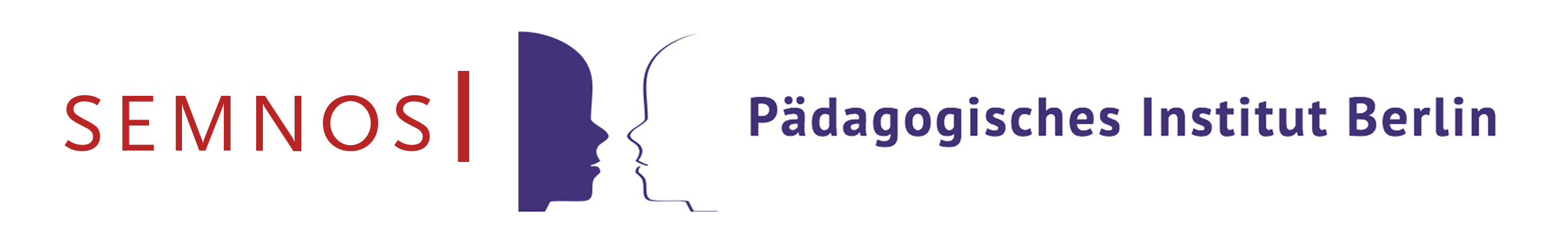„Nie mehr allein. Die neuen Lehrer: Während Pädagogen Einzelkämpfer waren, werden sie jetzt zu Teamplayern“ – jubelt die „Zeit“ am 25. Februar dieses Jahres und bezieht sich mit dieser Überschrift auf eine Studie der „Bertelsmann Stiftung“ „Lehrerkooperation in Deutschland. Eine Studie zu kooperativen Arbeitsbeziehungen der Sekundarstufe I“, in der mehr als 1.000 Lehrer zu ihrer Arbeit und ihrem Selbstbild befragt wurden. „So gut wie alle Pädagogen (97%) meinen, dass Lehrer heute im Team zusammenarbeiten müssen. Zwei Drittel sprechen schon jetzt regelmäßig miteinander über einzelne Schüler, geben sich Tipps für die nächste Mathe- oder Deutschstunde oder tauschen Arbeitsblätter oder Bücher aus“, hieß es da fast triumphierend.
Blickt man hingegen genauer hin und nimmt die Studie (https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/lehrerkooperation-in-deutschland/ )beim Wort, entdeckt man schnell, dass der Optimismus, den die Titelzeile der „Zeit“ verbreitet, der Wirklichkeit an unseren Schulen nicht ganz gerecht wird. Zwar helfen sich Lehrer, wenn auch nur 60%, gerne in „technischer“ Hinsicht, d.h. sie tauschen Arbeitsmaterialien oder Unterrichtstipps aus, aber gerade einmal 20% von ihnen geben dabei komplexere Formen der Zusammenarbeit, bezogen auf ihren Unterricht, zu Protokoll. Noch seltener berichten Lehrer davon, dass sie regelmäßig bei Kolleginnen hospitieren und Feedback geben – ganze 9% machen das. Und ein gegenseitiger Austausch bzw. gegenseitige Unterstützung – eventuell auch unter Einbeziehung von Experten – hinsichtlich der in Schule und Unterricht doch stets auftauchenden Probleme mit Schülerinnen und Schülern auf der Beziehungsebene findet in der ganzen Studie überhaupt keine Erwähnung!
Von daher ist auch nicht verwunderlich, dass in einem am 5. 7. 2016 auf spiegel online erschienenen Artikel „Flüchtlingskinder in der Schule: Wenn Grundschüler plötzlich von ‚Kanaken‘ sprechen“ eine Grundschullehrerin bedauert, in ihrer Situation überhaupt keine Hilfestellung bekommen zu haben. Was war passiert? Eines Morgens stürmte, so ihr Bericht, eine Schülerin mit den Worten in ihre Klasse „Alle Flüchtlinge sind Ziegenficker. Alles Kanaken. Ich hasse Allah!“ Mir geht es an dieser Stelle weniger um den Vorfall an sich – hier empfehle ich den klugen Artikel von Jesper Juul „Gewalt und Radikalisierung vermeiden – eine Anleitung“ zum Problem im Umgang mit aggressivem Verhalten unter Mitschülern und Flüchtlingen, den wir mit freundlicher Genehmigung von Jesper Juul aus dem „Schweizer Elternmagazon“ neu auf unsere Website genommen haben –, sondern um die Feststellung der Lehrerin, mit ihrem Problem vollkommen allein gelassen worden zu sein. Sie, die sie das Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen bzw. dem Schulleiter suchte, hatte „nicht unbedingt das Gefühl, dabei richtig gut unterstützt zu werden“, erzählt sie. Wie wir der Bertelsmann-Studie entnehmen können, sicherlich kein Einzelfall! Und genau hier liegt das Problem, auf das sich auch in dieser umfassenden Studie keine Antwort findet – das Thema „Beziehung“ taucht in ihr in Zusammenhang mit der Kooperation unter Lehrern an sage und schreibe keiner Stelle auf.
Der amerikanische Soziologe Dan C. Lortie von der Universität Chicago, der die Arbeitsroutinen von Lehrern analysiert hat, stieß, wie in demselben ZEIT-Artikel zu lesen war, in diesem Zusammenhang auf zwei ungeschriebene Gesetze, denen fast alle Lehrer folgten: „Erstens: Wir sind alle gleich. Zweitens: Niemand darf mir in meine Arbeit reinreden.“ Er diagnostizierte eine „zelluläre Struktur“ der Schule, in der Unterricht zu einer quasi privaten Angelegenheit deklariert wird. Und ähnlich äußert sich auch Mareike Kunter, Professorin für Pädagogische Psychologie an der Universität Frankfurt am Main: „Lehrer haben in ihrem Beruf wenig Begleitung. Anders als Psychologen, die Supervision bekommen, oder Ärzte, die eine Weiterbildungspflicht haben. Wenn Lehrer mit ihrer Ausbildung fertig sind, erfahren sie im Alltag keine strukturell verankerte Unterstützung mehr. Es bleibt dem Einzelnen überlassen, seine Defizite zu erkennen und etwas dagegen zu tun.“
Beziehungspädagogik dagegen geht davon aus, dass Bindungserfahrungen und die Beziehung zwischen Pädagogen und Schülern sich nicht nur auf den Lernerfolg (im Gegensatz zum völlig beziehungslosen Bulimielernen) auswirken, sondern dass die gemeinsame Reflexion von Lehrern über ihr Beziehungs- und Bindungsverhältnis zum einzelnen Schüler insbesondere bei herausforderndem Verhalten eine unablässige Voraussetzung ist, um auftretende Konflikte im Klassenzimmer in den Griff zu bekommen und sie produktiv zu lösen. In meinen Beiträgen auf diesem Blog „Beltz Forum: Beziehungskompetenz – bindungstheoretische Überlegungen zum Umgang mit herausfordernden Schülern im Unterricht“ oder „Bildung braucht Beziehung“ können Sie dazu mehr lesen.
Das PIB unterstützt Schulen durch Coaching und Weiterbildung bei der Bildung von Lehrergruppen, mancherorts auch „Reflexionsgruppen“ oder „Supervisionsgruppen“ genannt, die sich zum Ziel setzen, niederschwellig das Bindungs- und Beziehungsgeschehen in der Schule, in der Klasse und zwischen Lehrern und Schülern zu thematisieren. Im Herbst dieses Jahres werden wir damit beginnen, an ausgewählten Schulen ganzjährige schulbegleitende „Beziehungs- und Bindungsinseln“ zu begleiten und zu evaluieren, Gruppen von Lehrerinnen und Lehrern, die sich zum Beispiel einmal im Monat treffen, um über anstehende und mit dem Bindungsgeschehen und Beziehungen zwischen Schüler und Lehrer zusammenhängende Probleme zu sprechen. Wir sehen darin einen ersten Schritt, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre (oft selbstgewählte) Isolation verlassen und gemeinsam Probleme in Angriff nehmen, die sich nur mithilfe von auf Gegenseitigkeit beruhenden Erkenntnisprozessen und gegenseitiger Unterstützung lösen lassen. Dort, wo sich solche Gruppen bereits etabliert haben, profitieren sie bereits von ihrer zunehmenden Beziehungskompetenz, und ihre Teilnehmeri nnen berichten von einer spürbaren Reduktion von Stress und Frustration und Verbesserung des Schul- und Klassenklimas.