Beitrag von Claus Koch
Jetzt ist es wieder soweit: Landauf, landab verlassen die Kinder ihre Kitas und mit ihrer Einschulung beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Neugierig sind sie und aufgeregt. Das Abenteuer Schule kann anfangen! Stolz stellen sie fest, bald nicht mehr zu den „Babys“ zu gehören, die noch nicht einmal schreiben, lesen und zählen können. Fast alle freuen sich, endlich in die Schule zu kommen. Dahinter verbirgt sich ihre unausgesprochene Erwartung, immer selbstständiger zu werden, die Welt auf eigene Faust zu entdecken, sie erklären zu können und immer mehr verstehen zu lernen, was um sie herum geschieht. Um es so zu verändern, wie sie es sich vorstellen.
Psychologen nennen das etwas umständlich „Selbstwirksamkeit“. Einfach das Gefühl haben, das zu schaffen und zu erreichen, was man sich vornimmt. Aber auch, es an den eigenen Kriterien zu messen und nicht immer daran auszurichten, ob es den Erwachsenen gefällt oder nicht.
Soweit zu den Erwartungen der Kinder. Kommen wir jetzt zu den der Erwachsenen. Schon der Tag der Einschulung wird – im Übrigen verblüffend ähnlich zur Abiturfeier zwölf oder dreizehn Jahre später – von vielen zum Riesenevent gemacht. Für die Familienfeier werden mancherorts Restaurants schon Monate im Voraus angemietet, Clowns und Märchenprinzessinnen beauftragt, die Kinder zu unterhalten. Oft kann die Schultüte gar nicht groß genug sein, eine reicht manchmal schon gar nicht mehr aus. Und immer häufiger wechseln, im Vorgriff auf spätere Ereignisse dieser Art, bereits schon jetzt beträchtliche Geldsummen ihren Besitzer. Natürlich ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass die Kinder an diesem Tag ganz im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Nur – tun sie es wirklich? Sind es nicht vielmehr die Erwachsenen, die solcherart Inszenierung betreiben, um damit anzudeuten, worauf es jetzt ankommt? Dabei zu sein im Wettbewerb, der jetzt auf ihre Kinder zukommt, die Nase vorn zu haben. Nicht unbedingt deswegen, weil Eltern solcherlei Konkurrenzdruck für ihre Kinder selbst so toll finden. Sie sehen ja oft bei sich selbst, wohin das führen kann. Oder wie ihre Kinder darunter leiden, wenn es in der Schule nicht so läuft wie gewünscht, wenn schon die Kleinen mit Schlafstörungen, Kopfschmerzen, unbändigem Bewegungsdrang oder stillem Rückzug reagieren. Aber viele Eltern machen mit, weil es ihnen ihre Umgebung einhämmert, Wirtschaft und Bildungspolitiker, Notenfetischisten und PISA-Kontrolleure, dass nur der oder die mit dem besten „Schnitt“ am Ende durchkommt. Getreu dem neoliberalen Statement: Wer verliert, ist selbst schuld. Dann sollte man auch schon am Tag der Einschulung nach außen sichtbar zu den „Winnern“ zählen.
Aber Kinder sind nicht blöd. Die meisten von ihnen merken an solchen Tagen, dass es gar nicht mehr um sie geht, um sie selbst, so wie sie sind, sondern nur darum, wie sie sein sollen. Sie spüren den Erwartungsdruck, der an sie gestellt wird und manche von ihnen bringen dann die Regie am Einschulungstag gehörig durcheinander, wenn sie sich aus der Erwachsenenwelt noch einmal zurückziehen, ihre Angst vor dem Fremden und Neuen herauslassen, von der Bühne des lauten Wettbewerbs noch einmal in die Kulisse verschwinden. Das Spiel nicht mitmachen. Andere werden aus Angst vor den Ansprüchen der Erwachsenen, vor die sie sich plötzlich gestellt sehen, unruhig, nervös, trotzig und aggressiv. Die meisten aber machen mit. Weil sie ihre Eltern nicht enttäuschen wollen. Deswegen „kooperieren“ sie, wie es der große dänische Familientherapeut Jesper Juul schon früh erkannt hat.
Manche werden einwenden, dass sich doch gerade für die Jüngsten die Atmosphäre, die sie in der Schule erwartet, im Gegensatz zu früher gründlich verändert hat. Womit sie sie durchaus Recht haben. Beteiligt daran sind besonders die Grundschullehrerinnen, die, im Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen an weiterführenden Schulen, nicht vergessen haben, dass Kinder nicht nur ihren Kopf mit in die Schule bringen, sondern auch ihre Seele. Dass Schule kein beziehungsfreier Raum ist, ein Grundsatz, von dem immer noch viel zu viele Pädagogen ausgehen. Was auch mit dem Alter der Grundschulkinder zu tun hat, die ihre „Beziehungsangebote“ Lehrerinnen und Lehrern gegenüber noch viel unverstellter und direkter äußern als später die Jugendlichen in den weiterführenden Schulen. Die aber, wenn sie denn kommen würden, solche Beziehungsangebote gerne annehmen würden. Nur dass die meisten älteren Schüler schon gar nicht mehr damit rechnen, dass ihr Lehrer nicht nur Fächer, sondern eigentlich auch sie unterrichten.
Dass die Beziehung des Schülers zum Lehrer und ebenso zu dem Wissen, das er vermittelt, die alles entscheidende Variable im Lernprozess ist, ist durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt. Obwohl diese, man möchte fast sagen, Allerweltweisheit, die jede und jeder von uns aus ihrer/seiner eigenen Schulzeit kennt, in der Lehrerausbildung völlig vernachlässigt wird, spüren gerade Grundschulpädagogen vermittels der ihnen anvertrauten Kinder, wie sehr es auf ihre Beziehungskompetenz und weniger auf ihre didaktischen Fähigkeiten ankommt, dass schulisches Lernen den Kindern Freude bereitet und ganz nebenher erfolgreich ist.
Wenn Lehrerinnen und Lehrer am Leben der Kinder selbst anknüpfen, an ihren Erwartungen, ihre Ängste und Hoffnungen spüren, wenn sie ihre Unterschiedlichkeit respektieren, ihre Authentizität und sie so annehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollen, ihre Stärken und Schwächen gleichermaßen akzeptieren, dann stellt sich im Klassenzimmer und auch außerhalb davon zwischen ihnen und den Schülern ein Resonanzraum her, der oft ein Leben lang erinnert wird. Aufseiten der Schüler: Als positives Beispiel dafür, angenommen und respektiert worden zu sein. Eigene Wissensinseln entdeckt zu haben, die vielleicht ein Leben lang halten. Auf Seiten der Lehrer: Erfolg gehabt und den Kindern für ihr Leben etwas gegeben zu haben. Aber dieses Szenarium birgt für Pädagogen wie Kinder immer noch die Tragik, dass es an der Alltagsrealität von dem, worauf Schule am Ende hinausläuft, scheitert, auch wenn ein langsames Umdenken beginnt. Wenn am Ende für alle Beteiligten nur der „Schnitt“ zählt. In Bayern liegt er bereits in der Grundschule bei exakt 2,33 fürs Gymnasium und 2,64 für die Realschule.
Viele Kinder und Jugendliche absolvieren diesen Weg, oft mit Unterstützung ihrer Eltern, die ihnen die krankmachenden Folgen ständiger Konkurrenz und ständigen Wettbewerbs nicht aufhalsen wollen, unbeschadet, auch dann, wenn ihnen ihre kindliche Vorstellung vom Einschulungstag bereits gründlich abhandengekommen sind. Die meisten von ihnen suchen sich dann neben der Schule Aktivitäten, bei denen sie sich wieder selbst spüren, die ihnen das Gefühl geben, wertvoll und selbstwirksam zu sein. Sie malen, machen Musik, sie spielen Theater und Tanzen, engagieren sich für die Umwelt, für andere Menschen, für „ihr“ Viertel. Andere aber reagieren auf den Zwang, immer nur funktionieren zu müssen, mit „(dys)funktionalen“ Störungen, wie es so passend dazu heißt. Wieder andere schießen sich mit großen Mengen Alkohol wenigstens für den Augenblick aus dem Konkurrenzdruck, dem sie erlegen sind. Betäuben sich mit Medikamenten und Drogen.
Eine gute „Beziehungs-Pädagogik“ in allen Schulformen kann dies nicht in jedem einzelnen Fall verhindern. Und dennoch: Jüngste Studien zeigen: Lehrerinnen und Lehrer sind viel wirkungsmächtiger als sie oft selbst glauben. Schon kleinste Veränderungen in ihrer Beziehung zum Schüler bewirken nachgewiesenermaßen auf der anderen Seite oft große Veränderungen. Und sie profitieren selbst davon. Ihre Arbeitszufriedenheit steigt ebenso wie ihr Wohlbefinden. Und manchmal ändert sich dabei nicht nur ihre Beziehung zum Schüler, sondern auch die zu sich selbst. „Selbstwirksamkeit“, die Erfahrung also, unabhängig von der nächsten verordneten Schulreform etwas verändern zu können, vermittelt Mut und Zuversicht, auch für das eigene Leben.
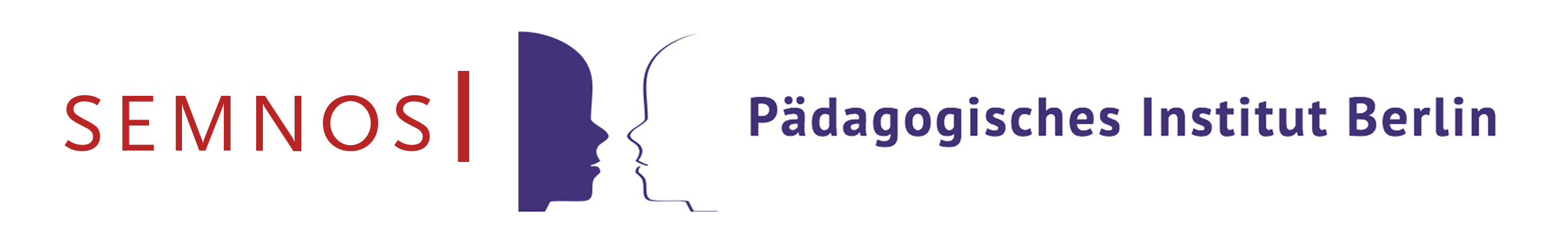
Eine Wohltat, dieser Text! Spricht mich sehr an; komme gerade aus dem Wald mit einer 7. Klasse und habe intensiv an der Beziehungskultur gearbeitet…👌