Ein Beitrag von Claus Koch
Vorbemerkung
Zwei Anlässe boten sich mir, noch einmal über wesentliche, u.a. auch von der Bindungstheorie abgeleitete Kategorien wie „Selbstwert“, „Selbstvertrauen“ und „Selbstwirksamkeit“ nachzudenken, die auch in meinem letzten veröffentlichten Buch über das Erwachsenwerden eine zugegeben bedeutende Rolle spielen.
Da ist zum einen die Beobachtung, dass sich ein hohes Selbstwertgefühl unter bestimmten Voraussetzungen nicht immer um emphatische Anteilnahme am Schicksal des Anderen ergänzt, sondern, im Gegenteil, anschlussfähig werden kann an die neoliberale Ideologie, dass nur der Einzelne und sein Erfolg zählen und der Schwächere selbst schuld daran sei, nicht zu den „Gewinnern“ zu gehören. Schon in der Kita trifft man auf von Eltern instruierte „Alphakinder“, in der Schule auf Jugendliche und später auf Erwachsene, die mit durchaus guten Bindungserfahrungen und gesundem Selbstvertrauen nur sich selbst und ihr Durchsetzungsvermögen gegenüber anderen im Kopf haben und dabei wenig übrig für die, die sie gerne als „sozial abgehängt“ bezeichnen.
Zum anderen führte ich im Sommer dieses Jahres ein längeres Gespräch mit dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juul, der mich darauf aufmerksam machte, dass ein hohes Selbstwertgefühl beim Kind oder Jugendlichen noch keine Garantie bedeutet, als Erwachsener bei Rückschlägen genau an dieser Stelle zu scheitern. Stattdessen käme es mehr auf das „Selbstgefühl“ an. „Selbstgefühl“ ist für Juul das, was ein Kind über sich selbst weiß, also über seine Gefühle, seine Gedanken und sein Verhalten. Man könnte es auch so ausdrücken, dass es im Leben mehr zählt, zu werden, wie man sich selbst sieht und entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen, statt danach zu trachten, welche Stärken andere, oft auch die Eltern, einem zumessen.
Im folgenden Beitrag gehe ich zunächst auf den Zusammenhang von (übertriebenem) Selbstwertgefühl und sozialem Dominanzstreben ein. In einem zweiten Beitrag folgt dann später der Versuch, zwischen Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und „Selbstgefühl“
genauer zu unterscheiden. Bei beiden Beiträgen handelt es sich um „Zwischenrufe“, um Anregungen zum Nachdenken, aber auch um mir wichtige Gedanken zu weiterer fachlicher Diskussion und wissenschaftlicher Forschung.
Gelungene Bindung
In der Bindungstheorie besitzen wechselseitige Prozesse wie Resonanz und Anerkennung hohen Stellenwert, ebenso wie daraus resultierende Zuschreibungen wie ein gutes Selbstwertgefühl oder selbstwirksam handeln zu können. Ausgangspunkt ist dabei ein gelungenes Bindungsgeschehen zwischen dem Kleinkind und seinen ihm wichtigsten Bezugspersonen. Schon kurz nach seiner Geburt sucht das Kind von sich aus den Kontakt zu ihnen, sendet Signale aus und hofft auf eine annehmende, es als selbstständiges Wesen anerkennende Reaktion. Dann wird sein Blick vom dem der Mutter erwidert, es wird, wenn es seine Ärmchen nach ihm ausstreckt, vom Vater aufgenommen, es entspannt sich ein regelrechter Dialog, wenn auf erste sprachliche Äußerungen geantwortet wird, wenn die angebotene Rassel glücksstrahlend (auf beiden Seiten!) zurückgegeben wird, usw. Nach und nach empfindet das Kind auf diese Weise eine Art Urvertrauen in seine Umwelt, das sich fortsetzt in eine Weltoffenheit, aus der Erfahrung heraus, von ihr freundlich angenommen zu werden. Das Kind fühlt sich als wertvoll, weil auf seine Gesten und Signale eingegangen wird („Ich bin es wert, dass man mir antwortet“), wodurch sein Selbstwertgefühl immer neue Nahrung erhält. Darüber hinaus fühlt es sich selbstwirksam, weil es die Erfahrung macht, durch das, was es tut, auch etwas produktiv verändern zu können. Seine Haltung, erfolgreich etwas bewältigen zu können, sieht sich bestätigt. Alles Schlüsselqualifikationen, die von großer Bedeutung sind, um auch später im Leben als Jugendlicher oder Erwachsener gut klarzukommen.
„Social dominance orientation“
Was aber geschieht, wenn Selbstwert und Selbstwirksamkeit sich ablösen von einem kommunikativen und emphatischen Miteinander und stattdessen schon früh mit der Zielsetzung „sozialer Dominanz“ verknüpft werden? Wenn es bereits im Kindergarten nur noch um „Förderung“, um Dreisprachigkeit und darum geht, es später einmal zu etwas zu bringen? Und dies erst recht in der Schule, wenn zunehmend Noten und Konkurrenzdenken den eigenen Kopf beschäftigen? Wenn es darum geht, aus einem „gesunden“ Selbstbewusstsein heraus möglichst der oder die Erste zu sein, um später im Kampf um begehrte Arbeitsplätze die Nase vorn zu haben? Wenn Eltern ihren „Projektkindern“ empfehlen, man müsse, um im Leben „durchzukommen“, notfalls auch gegen andere kämpfen, wie es die immer noch vorherrschenden hierarchischen Strukturen in unserer Arbeitsgesellschaft nahelegen. Gute oder gelungene Bindung, die ein hohes Selbstwertgefühl vermittelt und eine Haltung, das, was man sich vornimmt, auch schaffen zu können, lassen sich mit neoliberalen Tugenden, dass es nur von einem selbst abhängt, ob man etwas wird oder eben nicht, durchaus vereinbaren.
Amerikanische Forscher bezeichnen solcherart Eigenschaft auch als „Social dominance orientation“, eine mithilfe psychologischer Fragebögen messbare Eigenschaft, sich um jeden Preis anderen gegenüber durchzusetzen, bereit zu sein für den Kampf jeder gegen jeden. Menschen, die auf dieser Skala hohe Werte erreichen sind darüber hinaus anfällig für rechtspopulistische Vorstellungen, sie huldigen oft einer darwinistischen Ideologie des „Fressen oder gefressen werden“ und bevorzugen „Überlegenheits-Theorien“ gegenüber anderen Rassen, Gruppen von Menschen usw.
Bislang ging man davon aus, dass der Nährboden für eine solche Haltung eher in einer autoritär geprägten Kommunikationsstruktur innerhalb der Familie zu finden ist, in übertriebener Strenge und starren Regeln, denen sich die Kinder zu unterwerfen haben, um dann ihre Wut und Versagensängste auf „Schwächere“ zu projizieren. Was im Übrigen auch weiterhin gilt – sämtliche wissenschaftliche Studien zu diesem Thema sind sich darin mehr oder weniger einig. Aber die daraus resultierende Schlussfolgerung, ein Kind mit liberaler Erziehung und guter Elternbindung sei gegen hierarchisch motiviertes Denken und Handeln mehr oder weniger immun, könnte sich unter bestimmten Voraussetzungen als ein gefährlicher Irrtum erweisen.
Tauschwert: „Funktionieren“ und Empathievermögen
Es stimmt ja, noch nie war das Verhältnis der meisten Kinder und Jugendlichen zu ihren Eltern so entspannt wie heute. Wobei der „Tauschwert“ für ein solches entspanntes Verhältnis im Gegensatz zu früher für viele Kinder und Jugendliche nicht mehr in blindem Gehorsam liegt, sondern darin, im Rahmen von Konkurrenz und Marktgeschehen zu „funktionieren“, vor allem also, in der Schule die dazugehörigen Voraussetzungen für sich zu schaffen. Besonders wenn Abstiegsängste dazukommen gilt es dann, sich um jeden Preis durchzusetzen, den oder die andere aus dem Weg zu räumen, um etwas zu werden. Und genau hier entsteht eine Schnittstelle zum erworbenen Selbstwertgefühl und auch zur Einsicht, mit eigener Macht etwas verändern zu können. Genau hier kann beides anschlussfähig werden an soziales Dominanzstreben bis hin zu irrationalen Überlegenheitsphantasien.
Andererseits ist es aber auch so, dass das Kind im frühkindlichen Austauschprozess mit seinen Bezugspersonen lernt, die Binnenwelt des anderen zu erforschen, lernt, seine Antworten vorwegzunehmen, indem es sich in sie oder ihn hineinversetzt. Das Kind lernt, dass sich Freundlichkeit und Resonanzvermögen für es auszahlen, mit anderen Worten, es lernt, dass ihm sein empathisches Verhältnis zum anderen auch nutzt. Damit aber die solcherart erworbene Fähigkeit, sich in den anderen hineinzudenken, sozial entwertenden Haltungen entgegensteht, bleibt es immer wieder die Aufgabe von Eltern und ebenso von Bildungsinstitutionen wie Kita oder Schule, mitfühlendes und seinen Gegenüber mitdenkendes Verhalten zu fördern, damit sich Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit nicht von dem Gefühl für die Existenz des Anderen abkoppeln und damit sozialem Dominanzstreben Vorschub leisten. In einer Zeit, in der sich rechtspopulistische Ideologien und sie begleitende Vorstellungen „biologischer“ und sozialer Dominanz bis in die Mittelschicht ausbreiten, ist das eine wichtige Aufgabe (inkl. Selbstreflexion) sowohl für Eltern wie auch für Erzieherinnen und Lehrer/innen.
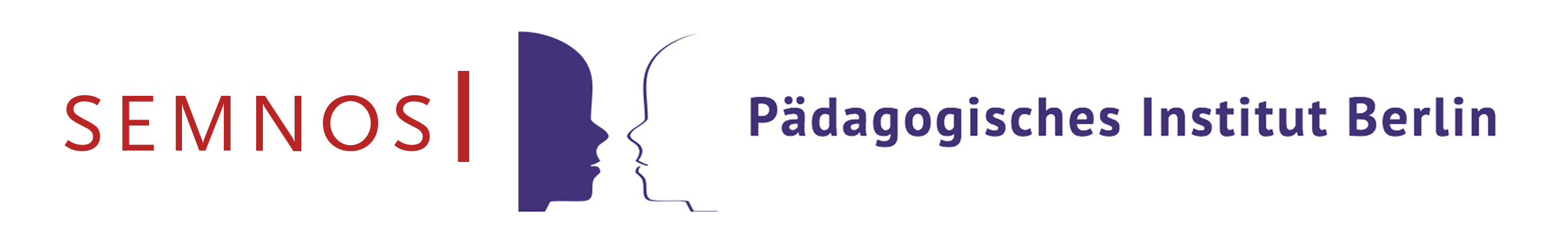
Pingback: Lernen Sie den neuen PIB-Newsletter kennen: Nr.1, September 2018 - Kinder und Würde