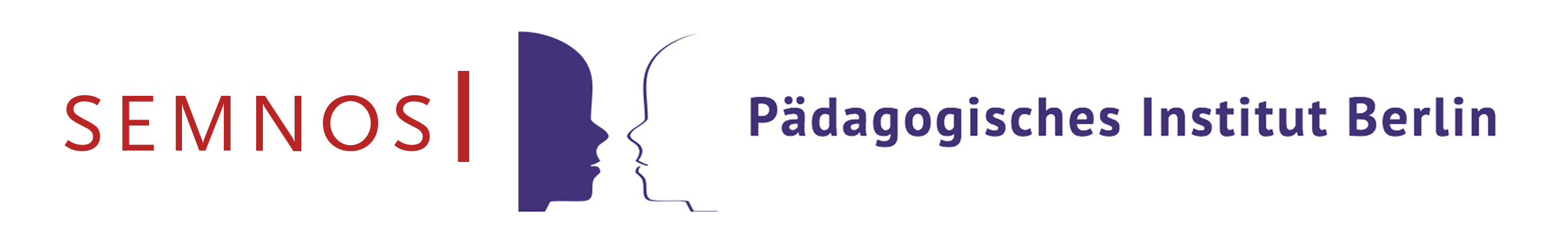Ein Beitrag von Dr. Claus Koch
In meinem letzten Beitrag „Bindungstheoretische Überlegungen zu den Wurzeln und Flügeln der 68er-Bewegung“ bin ich auf die Bindungslosigkeit der Nachkriegsjugend eingegangen, wie sie aus den Erziehungsmaximen ihrer Eltern resultierte, die sie aus der Kaiserzeit übernahmen und die später um die Erziehungsziele der Nationalsozialisten erweitert wurden. Der dagegen gerichtete Protest vieler Jugendlicher aus der 68er Generation öffnete ihnen die Möglichkeit, sich von den althergebrachten Vorstellungen ihrer Eltern zu lösen, neue Erziehungsziele zu formulieren und ein „Gegenmodell“ zum Leben der eigenen Eltern zu entwerfen. Von einem solchen „Generationskonflikt“ sind die heutigen Kinder und Jugendlichen weit entfernt. Die überwiegende Mehrheit von ihnen, laut jüngster Jugendstudien 70 bis 80 Prozent, wollen ihre Kinder später einmal genauso erziehen, wie sie selbst erzogen wurden. Das Verhältnis zu den Eltern ist heute partnerschaftlich geworden, die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden respektiert, Eltern und Kinder begegnen sich auf Augenhöhe.
Was aber passiert mit einer Jugend, die für sich nicht mehr das Bedürfnis verspürt, sich von den Eltern abgrenzen zu müssen, und stimmt die von vielen vertretene These, die „heutige Jugend“ habe es im Gegensatz zu früher viel einfacher, weil sie kaum noch Widerstände erfahre und über ihr Leben mehr oder weniger selbst bestimmen könne? Nicht so ganz. Denn mit der neoliberalen Wende, die sich bereits Ende des letzten Jahrhunderts ankündigte und mit dem narzisstischen Gebaren von Trump seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, rückten neue Erziehungsphänomene in den Vordergrund. Aus Kindern wurden vielerorts „Projektkinder“, denen zwar nahezu alles erlaubt ist – außer mangelnde Leistungsbereitschaft zu zeigen. Denn nur Bestleistungen in Kita, Schule und Studium seien marktkonform und sorgten für einen reibungslosen Übergang ins Marktgeschehen und garantierten den Erfolg im global ausgetragenen Leistungswettbewerb. Wer dabei auf der Strecke bleibe, sei dann eben selbst schuld – so die gängige Maxime.
Um es gleich zu sagen: Leistung zu erbringen ist per se nichts Schlechtes, und jedes Kind, schon die ganz Kleinen, und jeder Jugendliche ist stolz auf seine Leistungen. Das Gefühl, „etwas geleistet“ zu haben, befriedigt Kinder und Erwachsene gleichermaßen, sorgt für ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und trägt zu einem gelingenden Leben bei. Das Problem ergibt sich dann, wenn sich Leistungsforderung von Bindungs- und Resonanzprozessen abkoppelt und zum Fetisch wird: Wenn in der Beziehung der Eltern zum Kind nicht mehr das Kind in seinem „So-Sein“ zählt und respektiert wird, sondern an seine Stelle ein projiziertes Objekt rückt, das vermeintlich gesellschaftliche Vorgaben zu erfüllen hat. Wenn also aus Kindern Projektkindern werden, die der täglichen, oft verinnerlichten und von ihnen verheimlichten Bedrohung unterliegen, von Eltern und Gesellschaft dann bestraft zu werden, wenn dem neoliberalen Dogma, sich robust am Markt durchzusetzen, nicht genügen. Wenn zuhause nur noch dann der Alarmknopf gedrückt wird, wenn die Leistungen in der Schule nachlassen – alles weitere, zum Beispiel die Kompensation von Ängsten durch Trinken oder Flucht in Drogen und Ersatzphantasien von Größe und Machbarkeit (z. B. nächtelanges Computerspielen über Monate und Jahre hinweg) werden oft eher hingenommen als ein Notendurchschnitt im Abitur mit einer „3“ vor dem Komma. Nur noch Selbstwert im Sinne von Selbstoptimierung zählt und Selbstwirksamkeit im Sinne sozialen Dominanzstrebens.*
Dasselbe Phänomen, nämlich marktkonformes Verhalten macht sich darüber hinaus noch an einem anderen Phänomen fest. Waren Outfit und Gebaren der 68er darauf aus, gesellschaftlich vorhandene Vorstellungen zu provozieren, geschieht heute in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder besonders bei Instagram genau das Gegenteil! Die Soziologin Beate Großegger beschreibt diesen Vorgang wie folgt: „Neu ist auch die Art und Weise der Selbstrepräsentation. Während der jugendliche Zeitgeist früher zum Etablierten auf Distanz ging und sich Jugendliche via Ästhetik, mit unangepassten Styles, von sozialen Erwartungen der Erwachsenengesellschaft abgrenzten, läuft es heute vielfach genau umgekehrt. Es dominieren marktgängige Beschreibungen.“ Ganz entlang neoliberalen Vorstellungen geht es dabei um „gezieltes Selbstmarketing – frei nach dem Motto: Wer nicht auffällt, fällt durch. Und eben deshalb ist die Bereitschaft hoch, sich an das Gewohnte und allgemein Gewünschte anzupassen.“ Und weiter: „Der Selfie-Kult, den wir hier beobachten, ist nichts anderes als eine jugendkulturelle Interpretation erfolgsgesellschaftlicher Prinzipien, die die Erwachsenengesellschaft nicht nur als neue Leitwerte akzeptiert, sondern die sie Jugendlichen heutzutage auch ganz konkret vorlebt. Regel Nummer 1 lautet: Das, was du tust, was du bist und was du hast, musst du auch herzeigen, sonst zählt es nicht, da du sonst weder Aufmerksamkeit noch Anerkennung finden wirst. Und als Regel Nr. 2 gilt: Erfolg hat, wer sich gut präsentieren an, zeige dich also immer so, wie du glaubst, dich zeigen zu müssen, um bei anderen anzukommen, und steigern damit deinen persönlichen Marktwert.“ Dieser macht sich dann nur noch am Sammeln möglich vieler Herzchen und Likes auf Instagram und Facebook fest, mit denen sich der eigene Wert auch quantitativ bemessen lässt. Wer in diesem allgemeinen Konkurrenzstreben nicht besteht, ist „Loser“ mit weitreichenden Konsequenzen für sein persönliches Empfinden bis hin zu ernsthaften psychischen Störungen, wie sie aus Nichtanerkennung und Ablehnung resultieren. Denn wenn Authentizität durch marktkonformes Verhalten ersetzt wird, machen sich Anerkennung, Selbstwert und Selbstwirksamkeit nur noch an Likes und Herzchen fest, und auch den Jugendlichen mit frühkindlich guter Bindung laufen Gefahr, in ihrer vergeblichen Suche nach Anerkennung im Netz ihre Bindungsfähigkeit zu verlieren. Zunehmend macht sich bei ihnen ein Gefühl von Leere, Zurückweisung und Vergeblichkeit bemerkbar, weil sie ihre Suche im Netz nach Kontakt und Bindung nicht mehr ausleben können und sie „offline“ an ihr scheitern. Wenn Eltern und die immer wichtiger werdende „Peer-Group“ diese sich an Äußerlichkeiten orientierende Lebenshaltung fördern, entsteht auf diese Weise ein Teufelskreis, aus dem zu befreien sich manche von den Jugendlichen schwertun. „Selfies“, so Beate Großegger, „liefern ihnen (den Jugendlichen) keine Antworten auf die Frage nach dem Ich. … Eher nutzen sie sie zur Flucht aus schwierig erlebter Selbstorientierung und finden in der Banalität der Selfie-Kultur Ablenkung.“
Schutz gegen diesen vielfach vorhandenen Druck zur Selbstoptimierung, sich den Vorstellungen der Erwachsenen- und Konsumwelt und den neoliberalen Forderungen an sie anpassen zu müssen, bieten auch jetzt noch immer die in der frühen Kindheit erworbenen guten Bindungsmuster, die wie ein Widerstandsnest gegen übertriebenen Anpassungsdruck wirken können, besonders, wenn die Eltern sie auch noch in der Transitphase zum Erwachsenwerden ihrer Kinder spürbar werden lassen.
*Zu diesem Beitrag siehe auch meine Blogbeiträge: „Selbstwert, Selbstwirksamkeit und soziales Dominanzstreben“ und „Werden, wie man sich selbst empfindet“ – ein Beitrag zur Abgrenzung von Selbstwert und Selbstgefühl“