Beitrag von Dr. Claus Koch
In diesem Jahr jährt sich der jugendliche Aufstand von 1968 zum fünfzigsten Mal. Historiker und Soziologen haben in zurückliegenden wie in den aktuell erscheinenden Büchern immer wieder auf die politische Bedeutung der Chiffre „68“ hingewiesen. Wenig oder gar nicht die Rede ist hingegen von den individuell-psychologischen Wurzeln der 68er-Bewegung, die ihr ihren ganz besonderen Stempel aufdrückten: Den Mut, in vielen Bereichen, u.a. auch in Erziehungsfragen, Neuland zu betreten, gesellschaftliche Utopien zu entwickeln und sich vom Bestehenden radikal zu verabschieden. Aber was hat „die 68er“ dazu motiviert, ein ganzes Gesellschaftsgefüge radikal in Frage zu stellen, und was bedeutet dies für die nach politischen Lösungen heutiger Probleme suchende Generation ihrer Kinder? In welchen Punkten unterscheidet sich deren Sehnsucht nach einer besseren Welt vom Aufbegehren ihrer Eltern?
In meinem gerade erschienenen Buch „1968. Drei Generationen – eine Geschichte“ versuche ich, diesen Fragen auch auf der Grundlage von bindungstheoretischen Überlegungen nachzugehen. Einige seien hier erwähnt.
Zuerst müssen wir mit einer Spurensuche bei der Elterngeneration der 68er beginnen. Denn am Anfang der Revolte stand ein Generationskonflikt, der sich, was das Verhältnis heutiger Jugendlicher und junger Erwachsener zu ihren Eltern betrifft, in diesem Ausmaß nicht mehr wiederfinden lässt. Eine wesentliche Rolle für den Konflikt der „68er“ mit ihren Eltern spielte dabei in Deutschland das politische Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus, das die Eltern der 68er mehr oder weniger stillschweigend ihren Kindern zur Aufarbeitung zuschoben.
Die Philosophin Hannah Arendt, die 1949/1950 aus ihrem Exil in den USA Deutschland besuchte, also zu einer Zeit, als viele der 68er geboren waren, schreibt in ihrem „Bericht aus Deutschland“ darüber, wie die Menschen dort wie „lebende Gespenster“ herumlaufen, Menschen, die man „mit Worten, mit Argumenten, mit dem Blick menschlicher Augen und der Trauer menschlicher Herzen nicht mehr rühren kann“. Sie stellt eine dieser Generation zugrundeliegende „Taubheit“ fest, ihre stillschweigende Solidarität mit den Tätern und das Verschweigen der Opfer. Einen „allgemeinen Gefühlsmangel“ und die „tief verwurzelte, hartnäckige und gelegentliche brutale Weigerung, sich dem tatsächlichen Geschehen zu stellen“. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen ein Jahrzehnt später die Psychoanalytiker Alexander und Margarete Mitscherlich in ihren Büchern, „Die Unfähigkeit zu trauern“ und „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“.
In diesem Nebel, einer Mischung aus Schweigen und Gefühllosigkeit, verbrachten die meisten 68er ihre Kindheit. Aber das war nicht alles. Denn die meisten ihrer Eltern, die Erzieherinnen in den Kindergärten und Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen übernahmen mehr oder weniger die Erziehungsprinzipien, die man ihnen im „Dritten Reich“ verschrieben hatte. Zuerst von ihren eigenen Eltern und dann immer mehr beeinflusst von den Erziehungszielen der NS-Diktatur. Deren Ratgeberikone hieß Johanna Haarer und es ging ihr nicht mehr bloß um die Prinzipien einer autoritären Erziehung, wie sie schon in der Kaiserzeit üblich waren. Jetzt galt es vielmehr, die Mütter zum offenen Bruch mit der Bindung zu ihren eigenen Kindern aufzufordern, um sie dem Nationalsozialismus und seinen politischen Ziele dienstbar zu machen. In ihrem millionenfach gelesenen Bestseller „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ schrieb Johanna Haarer ihre Grundsätze nieder. Im Befehlston empfahl sie den Müttern, sich ihre Kinder bloß auf Distanz zu halten. Keinesfalls dürften sich „Verzärtelung“ und „Verwöhnung“ breitmachen. Nicht länger sollten Mütter „mitleidvolle Seelen“ sein. Um jede Bindung zu verhindern, darf das Kind weder getröstet noch soll ihm mit Blicken und Worten das Gefühl vermittelt werden, als eigenverantwortliche Person anerkannt zu werden. Ziel sei es vielmehr, dass es sich ganz in den Dienst der „Volksgemeinschaft“ stellt.
Im Dunstkreis dieser Erziehungsmaximen einer offen proklamierten Bindungslosigkeit, die Ziele des Nationalsozialismus, denen sie ursprünglich dienen sollten, einmal weggelassen, wuchsen viele der 68er auf. In sprach- und oft gefühllosen Beziehungen zu den Eltern. Sie wurden im Kindergarten in den Besenschrank gesperrt, wenn sie nicht aufaßen, „was auf den Tisch kam“, und in der Schule und in Heimen, auch mit Schlägen, „auf Vordermann“ gebracht, wenn sie nicht lernen und gehorchen wollten.
Sicherlich, der Aufstand, den die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Bundesrepublik ab Mitte der 60er probten, war politisch motiviert. Es waren vor allem die Bilder des barbarischen Vietnamkriegs, die die jungen Leute politisierten. Aber als ihr Protest begann, bezogen sie ihre Stärke paradoxerweise gerade aus jener Bindungslosigkeit, der sie bei ihren Eltern und darüber hinaus überall begegnet waren. Hier wuchs eine Generation heran, die das Gefühl hatte, nichts verlassen zu müssen, was es ihnen wert war.
Das aber sehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute völlig anders. Mitverantwortlich daran ist die Wende in den Erziehungsmaßstäben, die Mitte der 1960er Jahre einsetzte und an der die 68er in hohem Maße, trotz der Fehler, die in der „antiautoritären Phase“ begangen wurden, beteiligt waren. Der Generationskonflikt mit den Eltern, der die 68er so geprägt hat, ist heute passé. Im Gegenteil: Laut jüngsten Jugendstudien sind über 70% der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Meinung, dass sie ihre Kinder genauso erziehen würden, wie es ihre Eltern mit ihnen gehalten haben. Und das Glück in der Familie steht für die meisten Kinder und Jugendlichen auf der Rangliste ihrer Präferenzen an allererster Stelle. Ob bei Popkonzerten oder anderen „Events“ – Großeltern, Eltern, Kinder und Jugendliche sitzen vereint und einträchtig nebeneinander, für die 68er zu ihrer Zeit undenkbar!
Deren Kinder sehen nicht unbedingt ablehnend, aber skeptisch den zurückliegenden Aufstand ihrer Eltern und deren damalige Utopien und „revolutionären“ Ziele. Und wissen doch gleichzeitig, dass sich die Welt im Vergleich zur Welt, die ihre Eltern aufbegehren ließ, keinesfalls zum Besseren gewandelt hat. Ihr gewonnenes Selbstvertrauen, ihre überwiegend positive Bindung an die Eltern macht sie, zumindest äußerlich, stark. Vor die vielen anstehenden politischen Probleme gestellt, auf die eine eindeutige Antwort nicht zu finden ist, flüchten sich manche unter ihnen gerne in Selbstoptimierung oder sie entwickeln eine ausgesprochene Vorliebe für dystopische Entwürfe. Dann flüchten sie sich in eine Welt, wie sie sich außerhalb von Grenzmauern und Stacheldraht um Europa bereits erahnen lässt. Eine Minderheit – aber das waren die 68er schließlich auch – engagiert sich in NGO’s, in Bürgerinitiativen, in Umweltverbänden oder Flüchtlingshilfen. Ihnen geht es mehr darum, vom Gedanken an eine gelingende Zukunft immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzufinden, statt sich wie ihre Eltern großartigen Utopien zu verschreiben. Häufig verbinden sie ihre politischen Ziele mit einem persönlichen Projekt, woraus sie ihre Stärke, ihr Durchhaltevermögen und auch ihren Mut beziehen.
Gelungene Bindung rückt für diese Generation das Machbare in den Vordergrund, weil ihre positiven Resonanzerfahrungen in der frühen Kindheit ihr Gefühl von Selbstwirksamkeit gestärkt haben. Sie starten aus keinem beziehungslosen „Nichts“, sondern von einer Basis, die auch pragmatische Lösungen sinnvoll erscheinen lassen. Darin unterscheiden sie sich von den 68ern, deren Chance und gleichzeitige Gefährdung darin bestanden hatte, aus einem Niemandsland in ein neues Leben aufzubrechen.
Claus Koch: 1968. Drei Generationen – eine Geschichte. 288 Seiten. Gütersloher Verlagshaus 2018

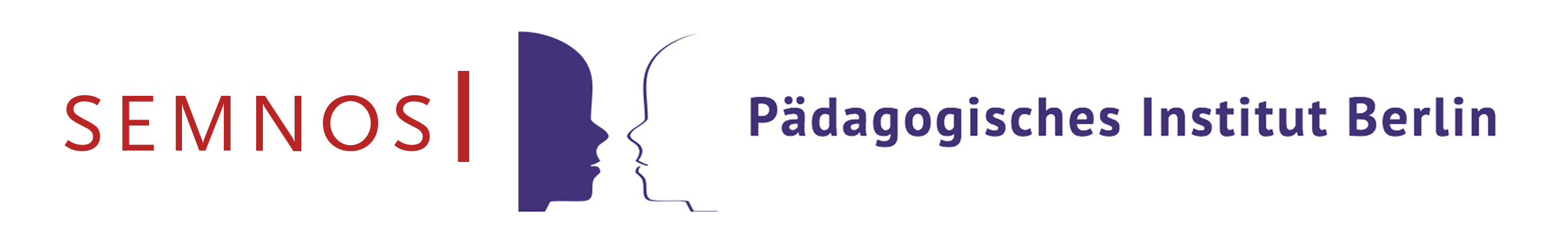
Momentanes Thema in den Medien, einseitige Berichterstattung und Kommentierung Gewalt an der Schule , Schüler, Eltern, Gesellschaft allgemein als Verursacher, die subtile Gewalt des Systems Schule und die, die Schule als Lebens- und Lernraum maßgeblich gestalten, werden nicht aufgefordert kritische ihre Haltung und ihre Beziehungsaufgabe dem Kind /Jugendlichen gegenüber zu reflektieren sondern werden zu werden hoch stilisiert. Rodari ital. Kinderbuchautor war der Auffassung, dass Erziehung und Bildung ein Prozess ist, bei dem Erzieher und Kinder Erfahrungen machen, sich dabei entwickeln und voneinander lernen können. „Der Erzieher ist dem Kind soweit überlegen, als er über die Tugenden der Geduld, der Bescheidenheit und der Toleranz verfügt.“ Ich kenne den Berufsstand Lehrer, ich war selber Schülerin, ich bin Mutter und Großmutter und war 31 Jahre Kollegin. Ich kenne die Gespräche in den Lehrer-zimmern. Die wenigen Kolleginnen und Kollegen die die Würde des Kindes und Jugendlichen achten wollten wurden häufig als Schülerfreundlich abgestempelt und als manchmal sogar als verantwortungslos dargestellt und somit entmutigt und entkräftet. Vielen Kollegen ist Beziehungsarbeit als Grundlage der Bildungsarbeit nicht wohl nicht bekannt. Ich suche Verbündete, die der Diskussion über Gewalt an der Schule mit einen wichtigen Reflexionsgedanken erweitert. Das System Schule und die notwendige Beziehungsfähigkeit und Beziehungsarbeit der Lehrer muss diskutiert werden. „Weil unsere Kinder unsere einzige reale Verbindung zur Zukunft sind und weil sie die Schwächeren sind, gehören sie an die erste Stelle der Gesellschaft.“ Olaf Palme