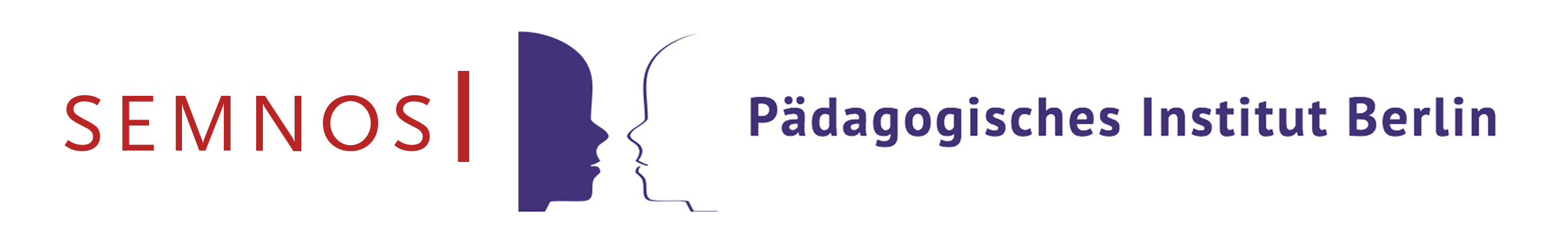Beitrag von Dr. Udo Baer
Familie Keller sitzt zusammen bei einer Geburtstagsfeier. Zehn Familieangehörige – Väter, Mütter, Kinder, Enkel, Geschwister – essen miteinander und unterhalten sich. Der Familienvater möchte die Suppe einschenken, seine Hand zittert, er kleckert und lässt schließlich die Kelle fallen. Bleich setzt er sich. Er sagt: „Ich wollte es eigentlich erst nachher sagen: Ich bin krank.“ Er informiert die Familie darüber, dass er an einer chronischen Krankheit leidet und zunehmend zu einem Pflegefall werden wird.
Sofort zeigt sich, dass eine Familie mehr ist als Verwandtschaft und regelmäßige Treffen: Jede Familie hat bestimmte Arten der Kommunikation, der Hierarchien von Aufmerksamkeit und Einfluss, hat Selbstbilder, Atmosphären und andere Eigenschaften. Wie dieses Familiensystem erlebt wird, ändert sich durch eine Krankheit, v.a. eine chronische oder lebensbedrohliche Erkrankung.
Was sich verändern kann, zeigen Studien und Auswertungen unserer Therapie- und Gruppen-Erfahrungen. Betrachten wir als Beispiel Familie Keller:
-
- Die Kommunikation: Die Familienmitglieder reden kaum noch über berufliche Veränderungen und die Schulergebnisse der Kinder, sondern über die Erkrankung und die Pflege des Erkrankten.
-
- Auch das Selbstbild kann sich verändern. Die Familie sieht sich nicht mehr als glückliche, sondern als eine durch Krankheit und Pflege belastete Familie.
-
- Bei den Kellers verändert sich sofort die Atmosphäre. Was vorher heiter und entspannt war, wirkt nun bedrückt und angespannt. Die Schwiegertochter, die etwas später hinzu kommt, spürt dies sofort und sagt: „Was ist denn hier los?!“. In den folgenden Wochen und Monaten treten unterschiedliche Gefühle auf: Trauer über die Krankheit und den drohenden Tod; Schamgefühle der Frau des Erkrankten, die meint, ihm nicht genug helfen zu können; Schuldgefühle, dass man die Erkrankung nicht vorher gesehen und vielleicht verhindert hat; Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber dem Leiden; manchmal auch Wut, in die die Hilflosigkeit umschlägt, Wut auf „das Schicksal“, auf „die Ärzte“, die nicht helfen können, Wut aus Überforderung, die sich auch gegen andere Familienmitglieder richtet, und andere mehr.
-
- Konkurrenz um Aufmerksamkeit: Die Enkel, die immer so schön mit dem Opa gespielt haben, bekommen nun nicht mehr seine Aufmerksamkeit, zumindest viel weniger. Geschenke gibt es, aber die Kraft reicht nicht zum Spielen. Auch die Tochter beklagt sich irgendwann bei der Mutter, dass diese sie gar nicht mehr fragt, wie es ihr gehe …
-
- Doch es wächst auch der Zusammenhalt. Wenn die Mutter nicht mehr kann, springen die Kinder bei der Pflege ein. Finanziell übernehmen alle Verantwortung, sie kümmern sich und reden mehr miteinander als zuvor.
Die unsichtbarsten Veränderungen erfolgen bei den Kindern. Da die Erwachsenen alle „stark sein“ wollen, bekommen die Kinder keine Vorbilder beim Traurig-Sein. Wenn sie „zu laut“ sind, schämen sie sich oder fühlen sie sich schuldig. Die Erwachsenen wollen die Kinder schonen und nicht zu sehr belasten. Doch damit belasten sie sie. Denn Kinder spüren den Druck und die Anspannung im System Familie. Und wenn sie etwas nicht genug erklärt bekommen, neigen sie dazu, sich aus Liebe selbst verantwortlich zu fühlen – und entwickeln Schuldgefühle, weil diese Verantwortlichkeit eine „mission impossible“ ist.
Was können Familien tun?
- Sie sollten möglichst viel miteinander reden. Auch zu klagen und zu jammern kann helfen. Wer alles in sich hineinfrisst, wird selbst krank und erhöht zumindest die Spannung in der Familienatmosphäre.
- Wenn Familienmitglieder hilflos sind, sollten sie Hilfe suchen. Welche Art von Unterstützung passend ist, dafür gibt es zahlreiche Beratungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, sich mit der Not und Hilfsbedürftigkeit anderen zuzuwenden. Wer hilflos ist, braucht Hilfe.
- Und wenn es in mancher Hinsicht, zum Beispiel bei der Heilung einer Erkrankung keine Hilfe geben kann, dann gibt es in Selbsthilfegruppen Hilfen beim Aushalten der Hilflosigkeit, Menschen, die trösten und unterstützen.
- Solche Menschen findet man oft außerhalb der Familie. Familie in Not durch chronische Erkrankungen neigen dazu, sich auf sich selbst zurückzuziehen, manchmal sich sogar von anderen abzuschließen. Da hilft es, bewusst Kontakte nach außen aufrecht zu halten und neue zu suchen, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen.
- Es ist wichtig, Gefühlen Raum zu geben. Wichtig ist, sich untereinander zuzumuten. Wenn Menschen ihre Not, ihre Trauer, ihren Zorn andere Gefühle vor anderen verbergen wollen, um sie nicht zu belasten, belasten sie sich selbst. Und sie irren sich. Denn die anderen Familienmitglieder bekommen in der Regel die versteckten Gefühle mit, zumindest die Belastung und den Kummer.
- Es ist gut und richtig, die Sorgen und die Not ernst zu nehmen und sich um die Erkrankung und die Erkrankten zu kümmern. Und es ist notwendig, auch den erfreulichen Seiten des Lebens Raum zu geben. Eine gute Musik, eine leckeres Essen, ein heiterer Film … – was immer gut tut, was immer neben dem Schatten auch der Helligkeit Raum gibt, sollte bewusst gepflegt werden.
- Insbesondere wenn Kinder sind, sollten deren Geschwistern „krankheitsfreie“ Räume durch Aktivitäten, Ausflüge, Gruppen usw. ermöglicht werden.
Familien sind immer auch Verantwortungs-Gemeinschaften. Früher sorgten die Familienmitglieder gemeinsam dafür, dass die Familie überleben konnte: durch Anbau von Nahrung, Tierzucht, Hausbau und -instandhaltung. Heute wird diese Verantwortlichkeit vor allem deutlich, wenn Familienmitglieder in Not sind, zum Beispiel durch eine chronische Erkrankung. Manche Familien fallen dann auseinander und zerstreiten sich. Andere schließen sich fest zusammen. Solche familiäre Solidarität ist gut und nützlich. Doch sie kann auch negative Wirkungen haben. Studien wie die von Barnowski-Geiser (Hören, was niemand sieht. 2009) über Kinder aus Familien, in denen Vater oder Mutter an Sucht- oder psychischen Erkrankungen leiden, wurden leider durch Beobachtungen und Untersuchungen von Familien mit anderen chronischen Erkrankungen bestätigt: Solche Familien können als Notgemeinschaft Tendenzen entwickeln, sich wie in einer Festung von einem Burggraben zu umgeben. Niemand kann heraus, alles muss alleine geschafft werden – und niemand kann herein und darf helfen. Solche Familien brauchen Ermutigung, die Zugbrücke herunter zu lassen, Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen.
Ein Beitrag anlässlich der Fachtagung der AOK Rheinland „Familienorientierte Selbsthilfe“ am 30.10.2012