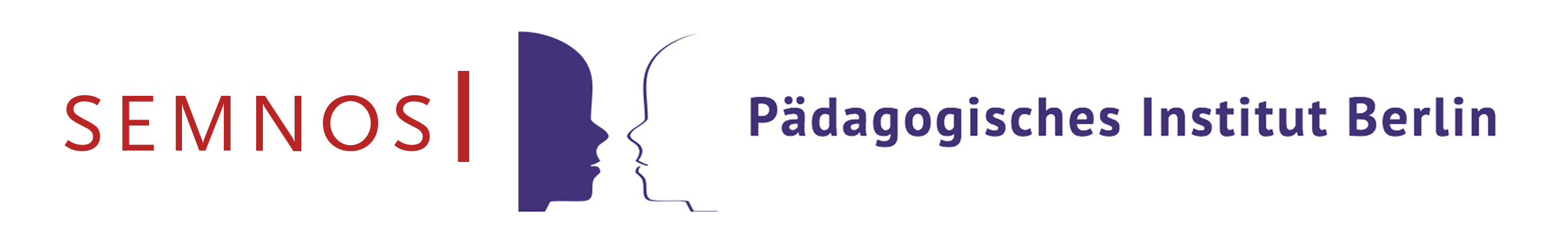Von bindungsfreundlicher Erziehung, „guter“ Autorität und Elternstress. Eine Miniserie zur aktuellen Erziehungsdebatte in drei Blogbeiträgen.
Erziehungsideale nehmen in ihrer Geschichte häufig einen wellenförmigen Verlauf. Auf eine auf Autorität und Unterwerfung des Kindes abzielende „schwarze Pädagogik“ in der deutschen Nachkriegszeit folgte als Gegenbewegung die Propagierung „anti-autoritärer“ Erziehungsprinzipien der 68er Bewegung, bevor dann in den1980er Jahren als eine Art von Kompromiss ein „autoritativer“ Erziehungsstil empfohlen wurde. Dieser zeichnet sich bis heute dadurch aus, dem Kind respektvoll und auf Augenhöhe zu begegnen und ihm gleichzeitig Regeln für sein Verhalten zu vermitteln. Mit den Büchern des Psychiaters Michael Winterhoff „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ und des Lehrers Bernhard Bueb „Lob der Disziplin“ – zwei der bis heute in Millionenhöhe meistverkauften Elternratgeber – erlebte das Vermächtnis einer auf Unterordnung und blinden Gehorsam beruhenden Erziehung Anfang der 2000er Jahre eine Art Revival. Parallel dazu plädierten der dänische Familientherapeut Jesper Juul, der Schweizer Kinderarzt Remo Largo und andere in ihren Erziehungsratgebern wiederum für einen das Kind würdigenden beziehungsfreundlichen Erziehungsstil, der seine Selbstverantwortung, Einzigartigkeit und Autonomie stärken sollte. Heute erleben wir wieder einmal einen leichten Wandel in der Erziehungsdebatte. Da wird eine beziehungs- und bindungsfreundliche Erziehung mit „bedürfnisorientierter“ Erziehung gleichgesetzt und dahingehend kritisiert, dass sie zu einer unnötigen Belastung der Eltern führen würde. Und plötzlich tauchen auf den Werbetexten von Büchern wieder Begriffe wie „gute Autorität“ und „Führung“ auf, ganz offensichtlich, um einen herrschenden Zeitgeist bedienen zu wollen. Artikel in den Leitmedien wie „Wenn Mütter zu sehr an Bindung glauben“ oder solche, die für eine Erziehung plädieren, unsere Kinder wieder zu mehr Leistungswillen anzuhalten, machen die Runde. Wieder einmal wird deutlich, dass Erziehungsragen immer auch gesellschaftspolitischen Tendenzen entsprechen. Zeit also für einige Klarstellungen.
Was eine bindungsfreundliche von einer „bedürfnisorientierten“ Erziehung unterscheidet
Der Begriff einer „bedürfnisorientierter Erziehung“ lädt zu einer Reihe von Missverständnissen ein, deren sich Kritiker einer bindungsfreundlichen Erziehung gerne bedienen. Zum Beispiel das Missverständnis, Eltern sollten möglichst auf jedes Bedürfnis ihres Kindes eine Antwort geben oder eingehen. Das aber ist, wie alle Eltern wissen, im Erziehungsalltag so gut wie nicht möglich. Und würde auch keinem Kind wirklich guttun. Schließlich macht es die Erfahrung, mit zunehmendem Alter und außerhalb seines Elternhauses mit seinen spontanen Wünschen und Bedürfnissen immer wieder auf Widerstände, aber auch auf Ablehnung zu stoßen, sei es in der Kita, der Schule oder im Zusammensein mit anderen Kindern. Ein Kind sollte bei sich zuhause mit freundlicher Zuneigung und Unterstützung seiner Eltern also gelernt haben, wie man damit am besten umgeht. Um das Missverständnis zu vermeiden, dass Eltern ihren Kindern bei möglichst vielen, wenn nicht sogar sämtlichen Bedürfnissen entgegenkommen sollen, ist es also angebracht, statt von „bedürfnisorientierter Erziehung“ von „bindungsorientierter Erziehung“ und ihren positiven Folgen für Kinder und Eltern zu sprechen. Dazu gilt es, zwischen zwei Arten von Bedürfnissen zu unterscheiden: Den grundlegenden Bedürfnissen jedes Kindes, die ich „existentielle Bedürfnisse“ nenne, und solchen Bedürfnissen, die auf bloße Wunscherfüllung hinauslaufen. Die Anerkennung existenzieller Bedürfnisse besonders in der frühen Kindheit ist ein Geschenk – für Kinder UND ihre Eltern.
Dazu im nächsten Blogbeitrag in 14 Tagen mehr