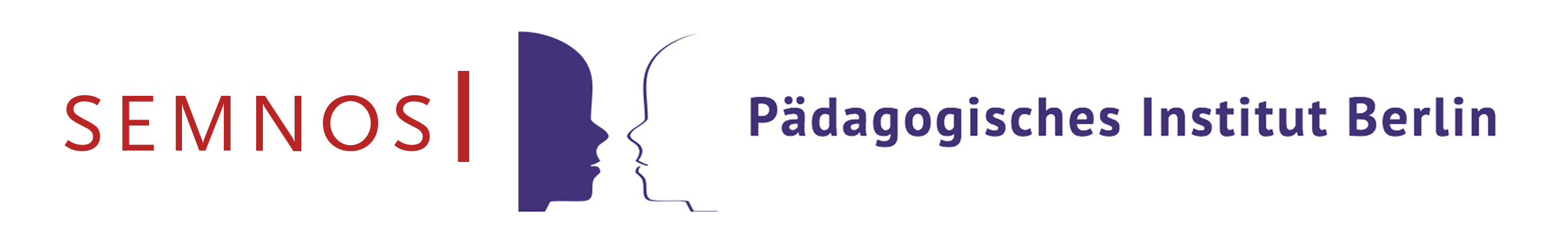von Claus Koch
Nahezu alle kennen „Die Sendung mit der Maus“. Und jetzt ist sie 50 Jahre alt geworden. Großeltern kennen sie, weil sie „die Maus“ vor langer Zeit das erste Mal zusammen mit ihren Kindern gesehen haben, heutige Eltern erinnern sich, wie sie mit ihren Eltern Sonntagmorgens vor dem Fernseher saßen, wo sie sich jetzt mit ihren eigenen Kindern einfinden, und auch diese Kinder werden sich schon bald mit ihren Kindern die Lach- und Sachgeschichten mit der Maus gemeinsam ansehen. Diese, im wissenschaftlichen Jargon: „intergenerationale Weitergabe“ ist sicherlich ein Erfolgsgarant für diese Sendung, der Grund dafür, dass sie bis heute bei Klein und Groß so beliebt geblieben ist. Ein anderer, dass die Geschichten, die die Maus präsentiert, nie belehrend und darauf aus sind, Kinder zu erziehen oder sie zu Konkurrenz- und Leistungsdenken zu animieren.
Die Sendung mit der Maus macht Kinder eben nicht zu Projektionsflächen für Erwachsene, Projektkinder kommen darin nicht vor. Die Maus kommt nie besserwisserisch daher, sondern immer ehrlich und mit ihrem deutlich hörbaren Augenzwinkern, verschmitzt und verspielt. Wissen wird nie mit dem Anspruch vermittelt, die Erwachsenen wüssten sowieso alles besser als ihre Kinder. Was übrigens auch für Sendungen für Kinder mit eher zweifelhaftem Ruf gilt: Nicht nur meine Kinder haben, als sie noch klein waren, neben dieser Sendung gerne die Teletubbies gesehen oder SpongeBob, gerade weil sie so unendlich harmlos, nicht belehrend und unschuldig-blöd daherkamen.
Darüber hinaus, und das ist vielleicht ihr wichtigstes Merkmal, ist die Sendung mit der Maus bindungsstiftend, ein wöchentlich gemeinsames Ritual, zu dem sich Mütter und Väter und ihre Kinder bis heute sonntäglich einfinden, sich nahekommen, gemeinsam lachen, sich freuen, schmusen und oft gemeinsam staunen. Kinder, dies ist bekannt, brauchen solche Rituale als Stabilitätsanker in einer für sie nicht immer übersichtlichen Wirklichkeit. Nach einer Woche mit allem Auf und Ab findet man sonntags gemeinsam zusammen. Resonanz und Nähe entstehen, Zusammenhalt, also alles Wichtige, was Kinder so brauchen. Ein, wie ihn der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Winnicott beschrieben hat, „Intermediärraum“ tut sich zwischen allen Beteiligten auf. In diesen Räumen, ähnlich wie bei den frühesten Lächeldialogen und Blickkontakten, kommen die Innenwahrnehmung des Kindes („Mir geht es gut“) und Außenwahrnehmung („Die Welt kommt auf mich zu) zusammen. Und aus solchen Zwischenräumen, kostbar, lautlos, unsichtbar und dennoch präsent, ergeben sich plötzlich Möglichkeitsräume, denn das Kind überträgt sein wohliges Erleben auf andere, außer ihm existierende Geschehnisse. Neugier entsteht und die Lust, den Dingen ohne Angst auf den Grund zu gehen. Statt ausgeklügelter Frühpädagogik und Leistungs-Didaktik sollten sich Kitas und Schulen an der Sendung mit der Maus ein Beispiel nehmen, wie Lernen am besten funktioniert: Dem Kind mit seinen existenziellen Bedürfnissen nach Geborgenheit, Anerkennung und Selbstwirksamkeit die Gelegenheit zu geben, sich und die Welt mit ihrer unendlichen Verschiedenheit angstfrei und mit großer Offenheit anzueignen.