Ein Beitrag von Claus Koch
In meinem letzten Beitrag „Selbstwert, Selbstwirksamkeit und soziales Dominanzstreben“ habe ich die Frage aufgeworfen, was geschieht, wenn sich Selbstwert und das Gefühl für Selbstwirksamkeit, zwei aus der Bindungstheorie abgeleitete wesentliche Dimensionen der Persönlichkeit, ablösen von einem kommunikativen und emphatischen Miteinander und sich stattdessen auf das Ziel sozialer Dominanz hin orientieren. In diesem Beitrag geht es erneut um eine kritische Diskussion dieser beiden aus guter Bindung resultierenden Persönlichkeitseigenschaften, dieses Mal jedoch unter dem Gesichtspunkt, warum die Unterscheidung von Selbstwert/Selbstwirksamkeit und Selbstgefühl im beratenden und therapeutischen Prozess eine so bedeutende Rolle spielen kann.
Sein Selbstwertgefühl entwickelt das Neugeborene und kleine Kind zunächst darüber, dass es sich in der täglichen Kommunikation mit seinen primären Bezugspersonen als „wertvoll“ empfindet. „Ich bin es wert, dass man mir auf meine Blicke, meine Gesten und Laute und späteren Worte antwortet“, empfindet das Kind, wenn Mutter und Vater oder andere ihm nahe Bezugspersonen auf die auf sein soziales Überleben gerichteten Kooperationsangebote feinfühlig eingehen. Wenn sich auf diese Weise nach und nach sein Selbstwertgefühl aufbaut, handelt es sich um eine Persönlichkeitseigenschaft, die bis ins Jugend- und Erwachsenenalter Schutz vor Mobbing und Feindseligkeiten bietet und gleichzeitig Selbstwirksamkeit verspricht: „Ich traue mir zu, das, was ich mir vornehme, auch bewerkstelligen zu können.“ Damit eng verbunden ist also auch das Vertrauen in sich selbst, das nur zustande kommen kann, wenn dieses Selbst für so wertvoll gehalten wird, dass es dieses Vertrauen auch zu verdient. Mit diesen, hier nur kurz zusammengefassten Wirkungen sind Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit in jedem Fall eine gute Basis für ein als sinnvoll und gelingend empfundenes Leben.
Allerdings ist die Entwicklung der Qualitäten und Ausrichtung von Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit, so, wie der gesamte Bindungsprozess, nicht auf die frühe Kindheit mit ihren primären Bezugspersonen begrenzt, sondern nach und nach treten weitere soziale Akteure auf den Plan, die versuchen können, diesen basalen Gefühlen eine andere Richtung zu geben. Ich habe im letzten Beitrag beschrieben, wie sich Selbstwert und Selbstwirksamkeit auf diese Weise mit der Verfolgung von „sozialer Dominanz“ in einem von neoliberalen Vorstellungen geprägten Umfeld gleichsam verschwistern können. Selbstwert und Selbstwirksamkeit werden dann in den Dienst sozialen Konkurrenzstrebens gestellt, den „Anderen“ auszuschalten, in der sozialen und beruflichen Hierarchie nach oben zu gelangen, der oder die „Beste“ zu sein oder auf andere, die dies nicht schaffen, selbstgefällig herabzublicken. Wobei die gelungene frühkindliche Bindung durchaus von Vorteil sein kann, zumindest dann, wenn durch das Streben nach sozialem Erfolg nach und nach das sie in der frühen Kindheit noch begleitende Gefühl für den anderen (Empathie, „theory of mind“) in den Hintergrund gerät. Genau dieser Prozess wird nun, und dies ist ein grundlegender Gedanke dieses Beitrages, von einer zunehmenden Entfremdung von sich selbst begleitet, mit anderen Worten, das Gefühl für sich selbst kommt dem oder der Betroffenen nach und nach abhanden und unterwirft sich, oft unmerklich, äußeren Zwängen.
Ich will dies an einem Fallbeispiel näher beschreiben. Ein Mädchen, nennen wir sie Clara, vierzehn Jahre alt, hat große Schwierigkeiten, sich in der Schule zurechtzufinden. Im Unterricht wirkt Clara oft schüchtern und zieht sich von den anderen zurück, sie hat keine Freundinnen und wirkt manchmal traurig und abwesend. Ihre Schulleistungen lassen nach, was zunehmend zu Auseinandersetzungen mit den Eltern und später zu einem Beratungsgespräch mit dem Schulpsychologen führt. Dieser rät den Eltern, statt ständig auf den Schwächen des Mädchens herumzureiten und ihm Nachhilfestunden zu verordnen, doch an seine Stärken anzuknüpfen, um auf diese Weise Claras Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu stärken. Als die Eltern ihm daraufhin sagen, wie begabt ihre Tochter beim Klavierspielen sei – sie habe schon mit fünf Jahren angefangen, Stücke von Chopin zu spielen – greift der Psychologe diese Auskunft dankbar auf und rät ihnen, ihre Tochter auf ein Musikinternat zu schicken, an dem sie an ihr Stärken anknüpfen könne. Was, nach kurzem Zögern des Mädchens, auch geschieht. Dort geht es Clara bald viel besser, sie findet sozialen Kontakt zu den anderen, schließt Schule und später ein Musikstudium erfolgreich ab und wird in ein angesehenes Orchester aufgenommen. Nach jahrelangen Auftritten kommt es bei einer Tournee, bei der sie gesundheitlich angeschlagen ist, zu einem Schwächeanfall auf der Bühne mit der Folge, dass sie fortan so starke Ängste vor neuerlichen Auftritten entwickelt, dass ihre Karriere als Pianistin in Gefahr gerät. Sie verliert zunehmend den Kontakt zu den anderen Mitgliedern des Orchesters und fängt an zu trinken. Nach einer Therapie, in deren Verlauf sie – im wahrsten Sinne des Wortes – allmählich zu sich selbst zurückfindet, kann sie ihre Musiklaufbahn fortsetzen und sich von ihrer beginnenden Sucht befreien.
Sehen wir uns diesen Fall genauer an. Der Berater hat, was zunächst einleuchtend erscheint, Claras Schulprobleme versucht dadurch zu lösen, dass er ihre Eltern auf Claras Stärken hinweist statt sich nur auf ihre Schwächen zu konzentrieren. Eine Strategie, die gegenüber jemandem, der sich, aus welchen Gründen auch immer, zunehmend als wertlos empfindet, auf den ersten Blick einleuchtet und in Beratungsgesprächen mit den allerbesten Absichten deswegen häufig angewandt wird – und die bei Clara zunächst ja auch eine positive Wirkung erzielt. Clara fühlt sich an dem an ihre Stärken anknüpfenden Internat wohl, gewinnt Freundinnen und Freunde und wird schlussendlich eine erfolgreiche Pianistin. Als sie einmal trotz Grippe auftritt und auf der Bühne einen Schwächeanfall erleidet (was an und für sich keine Katastrophe darstellt) bekommt sie plötzlich panische Angst, aus dem Gefühl heraus, das einzige, was ihrem Leben Sicherheit und Sinn verleiht, nämlich die Musik, zu verlieren. Darüber gerät sie in eine tiefe Lebens- und Sinnkrise.
Bei nachträglicher Betrachtung ist auffallend, dass sich das Beratungsgespräch mit dem Schulpsychologen nur auf das Selbstwertgefühl von Clara konzentrierte und dabei ihr Selbstgefühl völlig außer Acht ließ. Nicht die Frage, warum sie so schüchtern war und keine Freunde fand, nicht die Frage nach dem Bild, das sie sich von sich selbst machte, stand im Mittelpunkt der Intervention, sondern das Ziel, sie möglichst schnell wieder „stark“ zu machen. Ihre „Schwächen“ wurden dabei übergangen und fanden keine Berücksichtigung mehr. So baute Clara sich nach und nach mit der Konzentration auf ihre „Stärken“ einen „falsches Selbst“ auf, worauf sie in ihrer Therapie später häufig zu sprechen kam. Dieses Selbstbild hatte mit dem, was sie damals wirklich „in sich“ gefühlt hatte, nichts mehr zu tun, bzw. koppelte sie von ihrem Gefühl für sich selbst ab, zumal es ihr zunächst den erwünschten sozialen Erfolg einbrachte. Erst in der Therapie, die den Focus hin zu ihrem Selbstgefühl verschob, statt ihr Selbstwertgefühl zum Thema zu machen, fühlte sie sich, wie sie sich ausdrückte, das erste Mal „wirklich akzeptiert“, in ihrer Authentizität „angenommen“, gebunden: „So wie ich bin, bin ich richtig!“. In ihrer Familie war sie das jüngste Geschwister dreier in der Schule und im Studium sehr erfolgreicher älterer Brüder, die ihre Eltern ihr stets zum Vorbild machten. So fühlte sie sich immer wertloser, weil von äußerem „Erfolg“ ausgeschlossen und entsprechend allein gelassen. Sie sehnte sich nach Zuwendung und Verständnis, nach „Resonanz“, so, wie sich auch das Neugeborene in seinem Bindungsstreben danach sehnt, für seine wichtigsten Bezugspersonen „wertvoll“ zu sein. Aber als sie älter wurde, verlor sich diese Spur in ihrem Leben. Für ihre Eltern war jetzt, neben ihren Schulleistungen, wenn überhaupt, nur ihre außergewöhnliche Begabung am Klavier wertvoll, nicht sie selbst. Als ihre Schulleistungen nachließen und ihre Eltern mit ihr einen Schulpsychologen aufsuchten, fühlte sie sich erst recht wertlos. Ihr anfängliches Zögern, auf das Musikinternat zu gehen, rührte daher, dass sie schon damals bei sich spürte, einen falschen Weg einzuschlagen, der ihr Problem, sich nicht wertvoll und gebunden zu fühlen auf eine Frage von „Leistung“ reduzierte und den Beziehungsaspekt vollkommen vernachlässigte. Als sie dann über ihre musikalische Begabung zu sozialen Beziehungen fand, verbesserte sich ihr brüchiges Selbstgefühl vorübergehend, geriet aber in dem Moment in eine Krise, als die äußere Klammer der Bindung zwischen ihr und der Welt, nämlich ihr erfolgreiches Auftreten als Musikerin, nicht mehr hielt. Auslöser dafür war eine Lappalie. Aber ihr Selbstwertgefühl beruhte eben nicht auf dem Gefühl, sich selbst als wertvoll zu fühlen, sondern nur darauf, dass andere ihre Leistung, in diesem Fall ihre Darbietungen am Klavier, an ihr schätzten. Erst als die Therapeutin sie auf ihr Selbstgefühl, mit anderen Worten, auf ihr inneres Erleben ansprach und entsprechende therapeutische Interventionen vorschlug, gelang es Clara, über die Musik hinaus zu der Clara zu finden, die sie damals, bevor ihre Karriere begonnen hatte, gewesen war. Nach und nach kamen die in ihrer Beziehung zu ihren Eltern trotz anfänglich guter Bindung erlebten Enttäuschungen und Gefühle von „Entwertung“ zum Vorschein, die der Vorschlag, sich auf ihre „Stärken“ zu konzentrieren, nur verdeckt und nicht gewürdigt hatte.
Ich versuche zusammenzufassen. Dass sich das Neugeborene und kleine Kind in seiner Beziehung zu den primären Bezugspersonen als „wertvoll“ empfindet, ist unabdingbar für seine spätere gesunde psychische Entwicklung hin zum Jugendlichen und Erwachsenen. Solcherart Selbstwertgefühl schafft ein gutes Vertrauen in sich selbst, das Gefühl, so, wie man ist, angenommen und anerkannt worden zu sein, beides Voraussetzungen, auch spätere Lebensaufgaben erfolgreich in Angriff zu nehmen. In der Schule an den Stärken der Kinder anzuknüpfen, statt auf ihren Schwächen herumzureiten und sie dadurch zu beschämen, ist apriori nicht falsch – im Übrigen wählen wir Erwachsenen alle unsere Berufsbiographien entlang unserer Stärken und nicht entlang unserer Schwächen aus!
Gerade in beratenden und therapeutischen Settings aber lenkt eine unreflektierte Fokussierung auf die Stärken einer Klientin oder eines Klienten von seinem Selbstgefühl ab, davon, sich zunächst einmal selbst näher zu kommen. Die „Lösung“ besteht für den Klienten/die Klientin bei solcherart Konzentration auf sein „Selbstwertgefühl“ dann eher darin, so zu werden, „wie die anderen mich wollen“ als darin, so zu werden „wie ich bin“. Ein Selbstwertgefühl aber, das mehr oder weniger vom Urteil anderer abhängig ist, ist immer brüchig, denn es bleibt auf sie angewiesen und lässt das eigene Ich in seinem bereits in der frühen Kindheit angelegten Streben nach Selbstständigkeit ohnmächtig zurück. Und genau darin unterscheidet sich das auf einem guten Selbstgefühl beruhende Selbstvertrauen von einem Selbstwertgefühl, das sich nur am sozialen Erfolg orientiert. Letzteres mag zu einem äußerlich „erfolgreichen“ Leben durchaus beitragen, seine mangelnde Gründung im eigenen Selbst wird jedoch immer dann sichtbar, wenn der äußere Erfolg einmal ausbleibt und führt entsprechend häufig zu den in unserer Kultur und Gesellschaft hinlänglich bekannten Kompensationen, die entstandene innere Leere zu füllen.
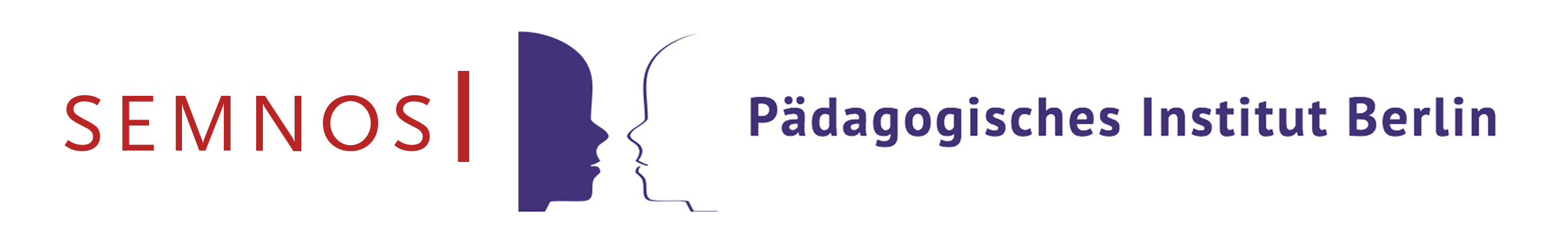
Pingback: Lernen Sie den neuen PIB-Newsletter kennen: 1. September 2018 - Kinder und Würde