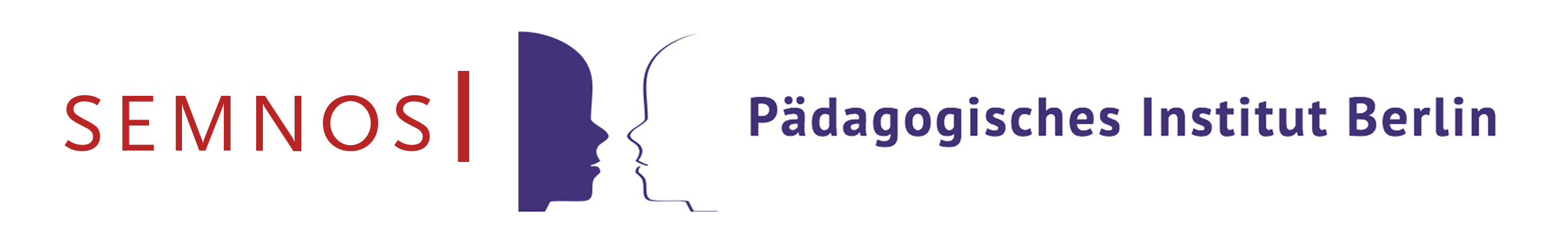von Claus Koch
Um den Gebrauch von Marihuana und Haschisch ist eine hitzige gesellschaftliche Diskussion entbrannt. Vordringlich geht es dabei um die Frage, ob man Cannabis künftig legal in kleinen Mengen und zum Selbstgebrauch in dafür lizenzierten Abgabestellen kaufen kann, zum Beispiel in der Apotheke.
Diejenigen, die für eine solche Legalisierung plädieren, führen als Argumente ins Feld, dass eine kontrollierte Abgabe die Gesundheit der User*innen insofern schützt, dass sie wissen, was sie da rauchen oder anderweitig zu sich nehmen. Denn im Park oder an irgendwelchen dunklen Ecken weiß niemand, was ihr oder ihm da buchstäblich angedreht wird. Hinzukommt die Kriminalisierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dabei erwischt werden, wenn sie sich, und sei es nur zum Selbstgebrauch, ein paar Gramm besorgen. Eltern können ein Lied davon singen, wenn sie die Mitteilung zugestellt bekommen, dass sich ihr Sohn oder ihre Tochter nach entsprechender Anzeige wegen des Verstoßes gegen das „BtMG“ (Bundesbetäubungsmittelgesetz) bei der nächsten Polizeidienststelle einzufinden haben, manchmal als „Zeugen“, um die Namen der Dealer herauszurücken, oder aber gleich von der Staatsanwaltschaft Post bekommen, die das Verfahren im Übrigen nach kurzer Zeit wieder einstellt. Was dem Familienleben oft nicht besonders gut tut und zu Konflikten führt, die das eigentlich doch gewünschte offene Verhältnis der jungen Leute zu ihren Eltern, auch was den Umgang mit Drogen betrifft, belasten.
Gegner der Freigabe führen ins Feld, dass die Droge, heute um ein Vielfaches stärker als noch vor zehn oder zwanzig Jahren, alles andere als harmlos ist. Dass sie im schlimmsten Fall Symptome hervorrufen kann, die einer Psychose ähneln. Dass starke Ängste und Panikattacken auftreten können. Andere wiederum leiden oft monatelang unter sog. „Flashbacks“, die ihre Angst, nicht mehr „normal“ zu sein, noch steigern. Und bei einigen führt der lang andauernde Gebrauch von Cannabis zu Apathie und Gleichgültigkeit. Einigkeit besteht bei allen Fachleuten darin, dass die Folgen umso schwerwiegender sein können, je jünger die User*innen sind. Ein Einstiegsalter mit 13 oder 14 Jahren, darüber berichten schon lange diejenigen, die sich therapeutisch mit der Drogenszene auskennen, ist nichts Ungewöhnliches mehr.
Beide Positionen Pro und Contra sind, auch argumentativ, nachvollziehbar, und es soll an dieser Stelle nicht darum gehen, für die eine oder andere Stellung zu beziehen. Eines aber steht fest: Egal, wie diese Diskussion auch ausgeht, viele Jugendliche und junge Erwachsene werden weiterhin kiffen, und jeder, der sich in seinem Bekanntenkreis einmal umhört, weiß, dass das ziemlich viele sind. Insofern geht der Streit um „legal“ oder „illegal“ an der Lebensrealität dieser Altersgruppe vorbei.
Was aber nottut und in der Diskussion viel zu kurz kommt, ist die Frage der Prävention, was mögliche gefährliche Folgen des Drogenkonsums betrifft. Statt nur über Strafen zu sprechen, muss es darum gehen, mit den Jugendlichen über den Gebrauch von Drogen ins Gespräch zu kommen. Es geht darum, mit ihnen offen über die Wirkung des rauschstiftenden THC zu sprechen und sie dabei ernst zu nehmen: ihren Freiheitsdrang, ihren Wunsch nach Selbstständigkeit. Und sie ebenso die Sorgen ihrer Eltern oder Lehrer wissen lassen. Sich über die Gründe austauschen, mit Drogen die Wirklichkeit hinter sich lassen zu wollen – übrigens auch legalem Alkohol. Gerade in dieser Altersgruppe können es eigene Ängste sein, Konflikte im Elternhaus oder Schwierigkeiten in der Schule. Auch Mobbing, das Schönheitsideal von Instagramm und sich selbst nicht zu genügen gehören dazu. Und deswegen gehört das Gespräch über Drogen und ihre Folgen an den Mittagstisch ebenso wie in den Schulunterricht. Denn die Kriminalisierung von Drogengebrauch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen führt auch zu einem Schweigekartell in dieser Altersgruppe und erschwert den gegenseitigen Austausch, übrigens selbst dann, wenn die schädlichen Folgen bereits sichtbar sind.