Ein Beispiel aus dem Bayerischen Bildungsplan
*Aus „kinderleicht“, 3, 2016, mit freundlicher Genehmigung von Herbert Renz-Polster
Wie unser Menschenbild als ganzes, so ist auch unser Bild vom Kind eine beständige Baustelle. Ein Blick in die Geschichte verdeutlicht das: Zu Zeiten unserer Groß- und Urgroßeltern sah man kleine Kinder in einem eher pessimistischen Licht. Babys seien als unberechenbare Triebnaturen geboren, die von den Eltern und der Gesellschaft zurechtgestutzt werden müssten. Durch strenge Zucht müssten sie „zivilisiert“ und für das Erwachsenenleben gehärtet werden. Dieses düstere Bild vom einzuhegenden Triebkind kam, natürlich, nicht von ungefähr: für die meisten Erwachsenen verlief das Leben damals in mehr oder weniger fremdbestimmten Positionen. Entsprechend war die Erziehung auf die Vermittlung von Disziplin, Gehorsam, Manieren und Regelmäßigkeit gerichtet. Insbesondere der „Eigensinn“ des Kindes wurde hart angegangen – in einer auf Befehlsketten aufgebauten Gesellschaft war der gewiss nicht erwünscht. Kein Wunder, dass es in den Kinderstuben streng zur Sache ging: das Kind sollte in körperlicher Distanz und nach klaren Vorgaben behandelt werden, die nicht ohne Grund an den Alltag beim Militär und in der damaligen industriellen Fertigung erinnern: gestillt und gegessen wurde nach der Uhr, nachts galt eine unbedingt einzuhaltende 8-stündige Kontaktsperre, und die „frühe Sauberkeit“ galt als wichtigster Ausweis der gelungenen Zähmung des Babys.[1]
Ein anderes Bild entstand in der Nachkriegszeit, in der sich die obrigkeitsorientierte, großindustrielle Gesellschaft allmählich zu einer partizipativen Dienstleistungsgesellschaft wandelte. Mit dem Aufbau der Konsum- und Servicegesellschaft rückte das Individuum und seine freie Entscheidungsmacht in den Mittelpunkt – und auch das kam in den Kinderstuben an. Statt als potenzieller Tyrann wurde das Kind jetzt zunehmend als Träger von Potenzialen angesehen. In der Wissenschaft wurde die Bindungstheorie „entdeckt“, und aus dem Familienleben wichen allmählich die Kampfbeziehungen und alltäglichen Machtverhandlungen. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern dürften den von dem US-amerikanischen Kinderarzt Benjamin Spock in seinen Büchern millionenfach verbreiteten Optimismus genossen haben: „Don’t be afraid to love your baby“![2] Dieses für den Aufbau bedürfnisgerechter Beziehungen offene Modell sollte sich im lauen Wind der Wirtschaftwunderjahre in der ganzen westlichen Mittelschicht verbreiten – und dort für eine Kindheit sorgen, die uns mit ihrem grundlegenden Optimismus heute fast schon fremd erscheint: die Kinder hatten ein eher leichtes Bildungsprogramm zu absolvieren, und auch wenn sich repressive Erziehungsmuster erst allmählich auflösten, genossen sie in der konkreten Ausgestaltung des Alltags aus heutiger Sicht schier unerhörte Freiheiten – etwa das selbst organisierte Spielen in informellen Kindergruppen, das es heute fast nicht mehr gibt.
Seinen Dämpfer erfuhr dieses optimistische Modell spätestens mit den 1990er-Jahren. Das „Wunder“ der Nachkriegsära mit seinem rasch wachsenden Konsum- und Aufstiegspotenzial kam zu seinem (heute wissen wir: vorhersehbaren) Ende. Gerade jetzt, wo sich ironischerweise das kapitalistische Modell als klarer Sieger im Systemwettbewerb gezeigt hatte, wurde eine neue Phase der Globalisierung eingeläutet – und sie sollte dafür sorgen, dass die Aufzüge in den westlichen Gesellschaften nicht mehr so leicht nach oben fuhren. Jetzt war der harte Wettbewerb um Märkte und Standortvorteile eröffnet. Der vorher sozial eingehegte und an politische Vorgaben gebundene Kapitalismus entwickelt in dem zunehmend übernationalen Wirtschaftsraum ein immer eisigeres Gesicht: die Reichweite der Löhne sinkt, die Arbeitsplatzsicherheit nimmt ab, die Ungleichheit nimmt zu. Mit diesem „neoliberalen“ Umbau der Wirtschaft wird nun auch der Alltag der Familien immer radikaler auf Produktivität und Konkurrenzfähigkeit getrimmt. An den Rändern der jetzt eher schrumpfenden Mittelschicht dominieren Abstiegsängste.
Natürlich bildet sich in diesem neuen sozioökonomischen Kontext auch ein neues Kinderbild – es wird „funktionaler“, die Beziehungen zum Kind orientieren sich zunehmend an einem „top-down“ Lernmodell. Als Leitmodell der Erziehung gilt jetzt entsprechend die möglichst frühe Bildung und Förderung durch Erwachsene. Das Modell der „Kindheit unter Kindern“ wird praktisch aussortiert. Die Kindheit ist jetzt „adultisiert“, und sie dreht sich immer mehr um die Förderung der am oberen Ende der Wertschöpfungskette gefragten, vornehmlich kognitiven Fähigkeiten. Bestand die Obsession unserer Großeltern in der frühen Sauberkeit der Kleinen, so lautet sie jetzt auf frühe Bildung.
Ein Fallbeispiel : Was genau heisst denn Freispiel?
Wie nachhaltig, und gleichzeitig subtil sich dieser Wandel des Kinderbilds vollzieht, und wie diese Änderungen dann auch ihren Weg in die Pädagogik finden, will ich an einem Fallbeispiel zeigen. Ich wähle dazu bewusst die wohl typischste Tätigkeit des Kindes, das Spielen.
Das Kinderspiel wurde in seiner Wertigkeit von Erwachsenen schon immer sehr unterschiedlich bewertet. Und das ist verständlich, schließlich erscheint das freie Spiel des Kindes zunächst einmal nutzlos – und „eigensinnig“ ist es auch. Kollisionen mit den Vorstellungen der Erwachsenen sind damit vorprogrammiert.
Hören wir einmal Arthur Schopenhauer zu, einem typischen männlichen Vertreter einer von eher düsteren Annahmen geplagten Zeit. Für ihn rangiert Kinderspiel bestenfalls unter der Rubrig „Tändelei“ – bei der sich die Minderleister der Gesellschaft treffen: »Zu Erzieherinnen unserer ersten Kindheit eignen die Weiber sich gerade dadurch, dass sie selbst kindisch, läppisch und kurzsichtig, mit einem Worte, Zeit Lebens große Kinder sind: eine Art Mittelstufe, zwischen dem Kinde und dem Manne, als welcher der eigentliche Mensch ist. Man betrachte nur ein Mädchen, wie sie, Tage lang, mit einem Kinde tändelt, herumtanzt und singt, und denke sich, was ein Mann, beim besten Willen, an ihrer Stelle leisten könnte.«[3]
Und heute? Hat das Kinderspiel sein schlechtes Image als nutzlose, unernste Beschäftigung noch längst nicht abgeschüttelt. Schon die ersten Forderungen nach »früher Bildung« (die damals ganz stark von den deutschen Arbeitgeberverbänden ausgingen) waren garniert mit dem Hinweis, dass man in den Kitas doch bitte das Spielen der Kleinen besser regulieren möge: Man wünsche sich, so die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in einem Positionspapier, eine bessere »Strukturierung« des Kindergartentages mit einer »Abwechslung von Lern- und Übungsphasen, Spiel- und Ruhephasen, mit Einzel- und Gemeinschaftsaktionen.«[4] Kurz: die Kleinen sollten nicht so viel Zeit beim Spielen verlieren und sich stattdessen besser mit dem beschäftigen, was jetzt für sie vorgesehen war: Bildung.
Auch in dieser Phase standen übrigens gleich die Erzieherinnen mit im Feuer. Viele von ihnen sähen „eine ihrer vornehmsten Aufgaben gerade darin, das Kind vor den Härten der Realität zu schützen«[5] – so Prof. Jürgen Kluge, der Initiator der bis heute erfolgreichen Bildungsinitiative »Haus der kleinen Forscher«. Der Unternehmensberater ging sogar so weit, die im Spiel vergeudete Kindheit als „Vernachlässigung“ zu thematisieren: »Der Versuch, den Kindern ihre Kindheit zu lassen, hat in Wirklichkeit zur Vernachlässigung von Kindern geführt.« [6]
Dieser in der damaligen Wirtschaftselite vorherrschende Pessimismus über das freie Kinderspiel sollte dann auch bald Teil der verfassten Pädagogik werden. Schauen wir uns an, was etwa der Bayerische Bildungsplan zum Thema „Freispiel“ zu sagen hat.[7]
Da dominieren vor allem die Hinweise auf die Rolle der Erzieherinnen. Ihre Aufgabe sei es „die Qualität der Freispielprozesse durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen zu verbessern.“ Um das zu begründen, werden die Kinder selbst als Kronzeugen aufgerufen: kein Kind wolle „nur spielen“ – es wolle sich vielmehr auch „mit ernsthaftem Tun“ befassen.[8] Im Grunde handelt dann die ganze Sektion 2.6 davon, mit welchen Methoden den Kindern für ihr (freies!) Spiel Anreize gesetzt werden können, damit es seinen pädagogischen Zweck erfüllt. Ziel müsse nämlich sein, dass sich das mit dem Spiel verbundene „beiläufige Lernen“ durch den Einsatz methodisch-didaktischer Mittel „zum spielerischen Lernen hin entwickelt“. Zu diesem Zweck solle dem Freispiel insbesondere „mehr systematische Begleitung und didaktische Aufbereitung zuteil werden“ – wie zum Beispiel durch „Projekte und Workshops.“ Workshops als Regulativ der unernsten Tändelei.
Dieses neue, angeleitete und pädagogisch aufgebesserte Spiel wird im Bayerischen Bildungsplan übrigens als „unterstütztes Freispiel“ bezeichnet. Und selbst in seiner „unterstützen“ Form sei es eher vorsichtig zu dosieren, denn wesentlich für die Kinder sei „das tägliche Erleben strukturierter Situationen als Lernmodell.“ Das unterstützte Freispiel müsse deshalb „in einem angemessenen Verhältnis zu Lernaktivitäten stehen, die die Erwachsenen planen und initiieren“.
Und genau hier zeigt sich, wie wenig schalldicht der öffentliche Raum eigentlich ist. Genau diese Aussage deckt sich ja praktisch vollständig mit der oben zitierten Ansage aus dem Bereich der globalisierten Wirtschaftselite.
Auch in der Pädagogik werden Interessen verhandelt
Ich will mit diesem Fallbeispiel zwei Grundmuster aufzeigen, die in der Bildungsdebatte manchmal übersehen werden.
Erstens: Die Ansagen, was denn in der Pädagogik als gut, richtig oder „modern“ gilt, kommen beileibe nicht nur von denen, die konkret mit Kindern zu tun haben – ob als Eltern oder Fachkräfte. Betrachtet man die Geschichte der Pädagogik, so fällt eher etwas anderes auf: Da reden überraschend viele mit, die mit Kindern eigentlich gar nichts zu tun haben. Und immer scheinen die, die in der Gesellschaft gerade das Sagen haben, sich auch Ansagen zur »richtigen« Erziehung zuzutrauen. Die Priester und Geistlichen des Mittelalters wussten, was gut für Kinder ist. Die Generäle im Deutschen Reich wussten es auch. Auch heute reden gerade in der Bildungsdebatte viele Menschen und Gruppen mit, die sich eigentlich um ganz andere Dinge kümmern – um Wirtschaftsunternehmen etwa oder um deren Stiftungen und Verbände.
So uralt es ist, so wenig ist dieses Grundmuster vielen Fachkräften, die ja tagtäglich die Inhalte der gerade gültigen Pädagogik am Kind umsetzen sollen, bewusst. Dabei könnte so manche kritische Frage für mehr Gelassenheit sorgen. Wie etwa die: Vielleicht interessieren sich manche, die da das Wort führen, ja weniger für die Kinder selbst – als vielmehr für das, was sie zu bieten haben, wenn sie erst einmal »gebildet und erzogen« sind? Vielleicht ändern sich ja deshalb die Ansagen in der Erziehung immer dann, wenn sich die Machtverhältnisse in den Gesellschaften ändern? Und vielleicht erklärt dies auch, warum die Forderung der Unternehmerverbände nach „mehr strukturiertem Lernen“ in den Kitas von Anfang an nicht etwa pädagogisch begründet wurde, sondern mit der Sorge, dass sonst »in Zukunft nicht mehr genügend Humankapital zur Verfügung steht, um den produktiven Einsatz des Sachkapitals zu ermöglichen«? [9]
Zweitens: Die Festlegung der tagesaktuell gültigen Pädagogik mag manchem als wissenschaftlicher Prozess erscheinen. Das greift nachweisbar zu kurz – auch wissenschaftlichen Annahmen und Konzepten liegen Annahmen über die angeblich „richtigen“ Bildungssziele zugrunde (das gilt auch für die damals hoch gehandelten Konzepte wie die „Meta-Kognition“ oder die „Ko-Konstruktion“). Im Grunde ist das Muster der Pädagogik ein eher simples: Zu ihrem Kern wird das geadelt, was am Kind gerade als verwertbar erscheint. Es soll später einmal das bringen, was gerade auf der Agenda der Gesellschaft steht und was den gerade tonangebenden Eliten nützlich erscheint.
Und genau deshalb werden sich die pädagogischen Ansagen auch weiter ändern – spätestens mit dem nächsten Kapitel unseres Gesellschaftsromans.
Herbert Renz-Polster
[1] Eine gute Übersicht dazu bei: Gebhardt, M.: Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen: Eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert. Deutsche Verlags Anstalt 2009
[2] Benjamin Spock: The Common Sense Book of Baby and Child Care, 1946
[3] Schopenhauer, Arthur: Über die Weiber, in: Kleine philosophische Schriften. Berlin: A. W. Hayn 1851, 2 Bde.: 465 S., 531 S., Erstausgabe. Online unter: http://aboq.org/schopenhauer/parerga2/weiber.htm
[4] Memorandum an die Bildungspolitik: Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände: Bessere Bildungschancen durch frühe Förderung. Positionspapier
zur frühkindlichen Bildung, 2006, S. 17/18, online: www.arbeitgeber.
de/www/arbeitgeber.nsf/res/Broschuere__Bildungschancen.pdf/$file/
Broschuere__Bildungschancen.pdf
[5] Jürgen Kluge: Schluss mit der Bildungsmisere, Campus 2003, S. 132
[6] Prof. Jürgen Kluge auf einer Rede vor der EU-Bildungsministerkonferenz
2.3.2007 in Heidelberg, online: https://www.bmbf.de/pub/
Bildungsministerrat_RedeKluge.pdf
[7] Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Der Bayerische Bildungsund Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, 5.,erweiterte Auflage, Cornelsen 2012, online unter http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/bildungsplan.pdf
[8] alle Zitate aus aus (7), Seiten 19 bis 21
[9] Christina Anger/Axel Plünnecke/Susanne Seyd: Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln: Bildungsarmut und Humankapitalschwäche in Deutschland. S. 108. Institut der deutschen Wirtschaft 2006
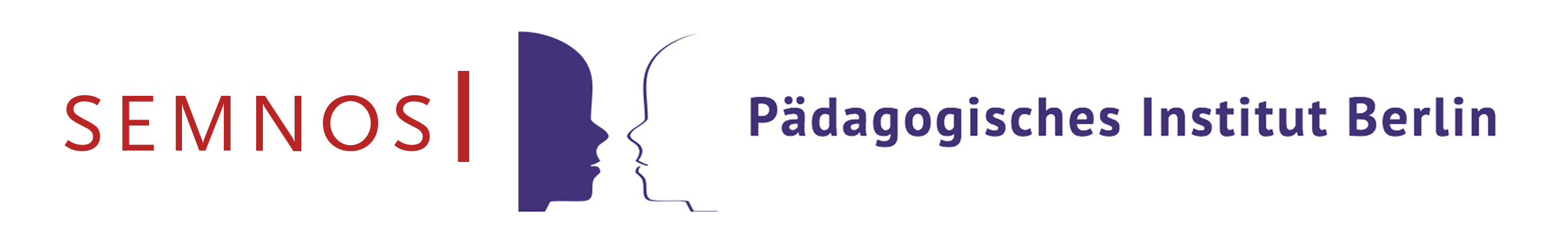
Dr. H. Renz-Polster, spricht hier ein wesentliches Dilemma der heutigen Praxissituation an: Nämlich, die Annahme der Praktizierenden, dass die neoliberale Pädagogik wissenschaftlich begründet sei und somit zur absoluten Einhaltung verpflichte – selbst wenn die Praxis zeigt, dass es sich um puren Unsinn handelt. Viele meiner jüngeren Kolleginnen fühlen sich verunsichert und halten sich deshalb sklavisch an die Vorgaben. Um diese „freiwillige“ Selbstaufgabe kritischen Denkens vor sich zu verschleiern und sich nicht eingestehen zu müssen, dass man sich von unsichtbarer Hand autoritär bevormunden lässt, flüchten viele in die Überzeugung, damit eine moderne Pädagogik zu betreiben und somit ebenfalls modern zu sein. Die Kehrseite dieser Medallie ist die permanente Erfahrung den »pädagogischen« Ansprüchen niemals zu genügen und sich somit erstrecht keine Kritik an den Zuständen – die nicht als kinderfeindlich erkannt werden – leisten zu können. Deshalb habe ich das Buch „Ich mach´ dich neoliberal“ – Im Wahn pädagogischer Konzepte veröffentlicht .
Dr. Renz-Polster ist für mich ein wichtiger Kritiker, dem es hoffentlich gelingt, in der Öffentlichkeit das nötige Gehör zu erlangen.
Vielen Dank
Renate Schmidt-Karakatsanis
Erzieherin