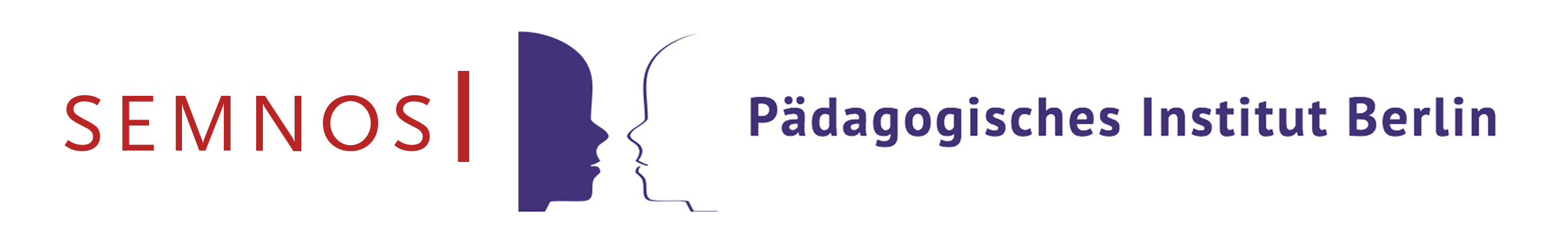von Udo Baer
Traumatische Erfahrungen bewirken in den Kindern, dass sie in all ihrem Erleben erschüttert sind. Dazu gehört auch ihr Gefühlsleben. Manche Gefühle verschwinden scheinbar, andere werden stärker, wieder andere verändern sich in ihren Inhalten und ihrem Ausdruck. Deswegen werde ich in den folgenden Abschnitten auf einige dieser Gefühle eingehen, die Veränderungen durch traumatische Erfahrungen beschreiben und Ihnen Hinweise geben, wie Sie damit umgehen können.
Es wird manchmal vermutet oder unterstellt, dass Kinder, die an traumatischen Erfahrungen leiden und aus anderen als der einheimischen Kultur kommen, anders damit umgehen oder gar die Schreckenserfahrungen anders spüren. Dazu sind einige Anmerkungen notwendig.
Erstens ist es mir wichtig zu betonen, dass menschliches Leid alle Menschen gleich betrifft. Ob ein Kind in Dresden oder in Aleppo geschlagen wird, ob es in Beirut oder München vergewaltigt wird, ob es seine Geschwister durch Bombenangriffe in der Ukraine oder in Afghanistan verliert – es ist das gleiche Blut das fließt; es ist der gleiche Schmerz, der gespürt wird; es ist die gleiche Not, die die Kinder und auch die Erwachsenen überkommt.
Wenn wir unter kulturellen Gesichtspunkten traumatische Erfahrungen betrachten, dann bildet der humanistische Aspekt den Boden. Alle Betroffenen sind Menschen, und im konkreten Leid gibt es keine kulturellen Unterschiede, keine religiösen, keine landsmannschaftlichen. Die einzigen Unterschiede liegen in den Besonderheiten der Empfindsamkeit oder der Widerstandskraft der einzelnen Individuen.
Dies zu betonen, ist uns wichtig, weil wir häufig der Haltung begegnen, dass man sich den traumatischen Erfahrungen der Kinder nicht widmen darf, weil man zu wenig über die kulturellen Unterschiede und Besonderheiten weiß. Wer Mitgefühl hat, weiß genug, um dieses Mitgefühl zu zeigen und Kinder zu schützen und zu trösten. Das ist meine grundlegende Aussage und meine immer wiederkehrende Aufforderung.
Kulturelle Unterschiede gibt es, auch wenn sie oft überschätzt werden. Wir müssen diese Unterschiede achten. Das ist selbstverständlich. Doch dazu gehört auch, dass wir diese Unterschiede genauer betrachten.
Ein Unterschied liegt in der Sprache. Es gibt in vielen Herkunftsländern geflüchteter Menschen keine Sprache der Therapie, der Psychologie oder Psychotherapie. Es gibt kein System der Trauma-Hilfe oder der psychischen Versorgung, so wie es in den fünfziger Jahren in Deutschland auch kein solches System gegeben hat. Wer krank ist, gilt meist als »verrückt«. Wer nicht mehr funktioniert, darf z.B. in der Dorfgemeinschaft »mitlaufen«, aber ohne dass besondere Gesundheits- und Versorgungssysteme existieren.
Auch das Wort Therapie ist in vielen Ländern unbekannt, zumindest in den ländlichen Gegenden. Als ich einem Vater erzählte, dass sein Kind wahrscheinlich einer Trauma-Therapie bedarf, rief er empört: »Nein. Ich gebe mein Kind nicht weg. Ich möchte mein Kind in der Familie behalten!« Durch Nachfragen wurde deutlich, dass er, aus Syrien kommend, ein Verständnis von Therapie hatte, dass Soldaten oder von der Armee oder der Polizei oder dem Geheimdienst beauftragte Ärzte Kinder unter dem Mantel der »Therapie« den Familien entreißen. In vielen Ländern wie der DDR oder der Sowjetunion, aber auch in vielen Diktaturen in Südeuropa oder in arabischen Ländern wurden bzw. werden Oppositionelle als psychisch krank diffamiert und in psychiatrischen Einrichtungen »weggesperrt«. Mit dieser Erfahrung kommen viele Menschen nach Deutschland. Wenn wir dann unbedarft von Therapie oder therapeutischer Hilfe reden, dann kann das einen Schrecken und Abwehr hervorrufen.
Ein weiterer kultureller Unterschied besteht darin, wie öffentlich mit Gewalterfahrungen umgegangen wird. Ein Mädchen, das sexuelle Gewalt erfahren hat – verdient es Hilfe und Solidarität? Oder ist es von der »Schande« gezeichnet und wird nie heiraten werden können? Wird es in der Öffentlichkeit ausgegrenzt und isoliert – oder erfährt es Solidarität?
Wir wissen aus der deutschen Geschichte, dass alleine von den ca. 2 Mio. Frauen in Deutschland, die nach Kriegsende vergewaltigt wurden, Zehntausende sich selbst getötet haben, weil sie mit dieser Erfahrung nicht weiterleben konnten und wollten. Viele andere wurden von ihren Männern, die aus dem Krieg heimkehrten, verstoßen und in den sozialen Gemeinschaften vor allem in den ländlichen Gebieten isoliert und verachtet. So fremd sind also solche Verhaltensweisen auch in Deutschland nicht. Hier haben sich viele Haltungen geändert, in anderen Ländern noch nicht. Es existieren in dieser Hinsicht Unterschiede zwischen den Kulturen. Hier gibt es einen großen Bedarf, sich miteinander offen und ehrlich, aber auch kritisch, auseinanderzusetzen.
Diese Unterschiede betreffen nicht das Leid der Menschen, sondern, um es noch einmal zu betonen, den öffentlichen Umgang mit den Leiderfahrungen! Wenn Sie darüber nichts oder wenig wissen, fragen Sie die betroffenen Menschen. Nach meinen Erfahrungen freuen sich die meisten und sind gern bereit, über sich und ihren kulturellen Kontext zu erzählen.
Ein weiterer Aspekt kultureller Begegnung besteht in dem, was wir als trans-kulturelle Erfahrungen bezeichnen. Es existieren heute kaum noch voneinander isolierte und abgegrenzte Kulturen. Wenn eine eritreische Familie in einem Flüchtlingslager gespendete Kleider erhält, dann freut sie sich besonders, wenn sie ein Hemd mit Adidas-Streifen findet. Adidas ist auch in Eritrea bekannt und bedeutet einen hohen Status. Ein Kind aus Afghanistan möchte gern Fußballer werden. Es malt auf das Bild eine 10 und sagt dazu »Ronaldo«. In fast allen Ländern gibt es gemeinsame kulturelle Inseln oder Dimensionen über den Sport, über Musik, über Stars, über Filme, über Nachrichtensender und dergleichen mehr. »Star Wars« gehört zur Kultur in Syrien genauso wie in Stuttgart.
Es gibt also nicht nur kulturelle Unterschiede, sondern auch über die kulturellen Unterschiede hinausgehende »transkulturelle Gemeinsamkeiten«. Von solchen Gemeinsamkeiten zu wissen und an sie vielleicht anzuknüpfen, ist wichtig und erleichtert die interkulturellen Begegnungen.